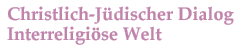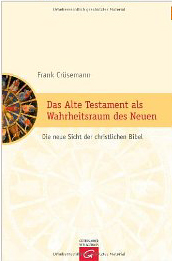Hans Maass rezensiert: "Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen"
Liebe und Sexualität in den Weltreligionen
[WEB.DE]Christen in Palästina: "Wut über israelische Siedlungspolitik"
Einheit der Menschheit
Gott in Wien
[DEUTSCHLANDRADIO]
Konsultation - Tagung
Was bedeuten für eine christliche Theologie, die universell ausgerichtet ist, die Verheißungen an das Volk Israel? Können die Hoffnungen auf das Reich Gottes verbunden werden mit den Verheißungen des Landes? Die Antworten fallen aufgrund unterschiedlicher Kontexte und hermeneutischer Zugänge verschieden aus und spiegeln sich wider in der theologischen Debatte um die Bedeutung des christlichen Bekenntnisses zur bleibenden Erwählung Israels.
Auf dem Hintergrund des „Kairos-Palästina- Dokuments“ sucht die Konsultation das Verhältnis von biblischen Landverheißungen an Israel und der universalen Heilsbotschaft Jesu Christi theologisch zu bestimmen, möchte dabei nach politischen Implikationen fragen und sich von Gesprächspartnern aus dem Nahen Osten herausfordern lassen.
Dabei sollen blinde Flecken entdeckt und weiterführende Antworten diskutiert werden. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die Evangelische Kirche in Baden (EKiBa) möchten mit dieser Konsultation Theologinnen und Theologen aus der Bundesrepublik ein Diskussionsforum bieten. Die Konferenzsprache ist Deutsch. Dazu laden wir herzlich ein und freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Referenten u.a.: Prof. Moshe Zimmermann (Jerusalem), Prof. Klaus Wengst (Bochum), Prof. Nicolas Abou Mrad (Tripolis).
Weitere Informationen, Kosten und Anmeldeformular:
Info-Flyer
Zu Gast bei ...
Nachfolgend lesen Sie einen Original-Beitrag des evangelischen Theologen Hans Maaß. Als Schuldekan und Kirchenrat war er über zwei Jahrzehnte im Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe für alle Fragen zuständig, die den Religionsunterricht an Grund-, Haupt-, Sonder- und Realschulen betreffen. 1992 - 2003/2004 Lehrauftrag an der PH Karlsruhe für Neues Testament und Judentum. Maaß ist u.a. Vorstandsmitglied im Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
COMPASS dankt dem Autor für die Genehmigung zur Wiedergabe
seiner Rezension an dieser Stelle.
Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen
Dr. Hans Maaß
Didaktisch geschickt wird der Problemhorizont mit einem Gemälde A. Dürers aufgerissen, das den zwölfjährigen Jesus auf einem Thron als »Lehrer Israels« und Erklärer der Schrift darstellt. Weitere Farbbilder zeigen auch andere Möglichkeiten, diese Szene zu verstehen und in jüdische Tradition einzuzeichnen. Gleich in diesem ersten Teil zeigt er, dass nicht nur das Verhältnis zur Schrift, sondern zugleichauch zur Gottesfrage und zum Land Israel betroffen sind. Aufschlussreich ist auch die Skizzierung seines eigenen theologischen Werdegangs.
Im zweiten Teil stellt er die bisherigen Modelle einer Verhältnisbestimmung beider Bibelteile samt ihren Aporien dar. Dabei nennt er Marcion und (in einem großen historischen Sprung) die Deutschen Christen als Beispiele für eine »völlige Ablehnung des Alten Testaments«. Neben Emanuel Hirsch und Friedrich Schleiermacher führt er Rudolf Bultmann als Beispiele für ein Kontrast-Verständnis an, wobei er diesem mit Recht »eine theologisch ungleich reflektiertere Gestalt dieses Grundmodells« bescheinigt, da er »die antisemitischen Voraussetzungen und Folgen« nachdrücklich ablehnte. Die jüdische Bultmannrezeption übersieht dies oft. In einem Aufsatz von 1933 hatte Bultmann geäußert: Es sei »sinnlos, das Christentum festhalten zu wollen und das Alte Testament zu verwerfen.« Man könne »sicher sein, dass das Christentum, das er festhalten will, kein Christentum mehr ist.« Dennoch ging es ihm um die Frage, worin das Neue am Christentum bestehe; dieses Anliegen behandelt Crüsemanns im Schlussteil des Buches. Eine völlig andere Verhältnisbestimmung erfolgt bei Martin Luther und anderen vor und nach ihm, die nach dem »Christuszeugnis« im Alten Testament fragen, aber auch bei denen, die Crüsemann unter dem Stichwort »Relativierung und Selektion« von Lessing über Wellhausen und Bonhoeffer bis Gerhard von Rad zusammenfasst.
Dieses Kapitel dient auch wie das folgende, »Wie viel Systematik erlaubt die Schrift?« der Vergewisserung des eigenen Standpunkts der Leserschaft. Der Methodik des gesamten Buches entsprechend bietet Crüsemann einen kritisch reflektierten Überblick über verschiedene Ansätze. Sein Augenmerk richtet er dabei sowohl auf die Versuche einer gesamtbiblischen theologischen Linie als erst recht auf die Einbeziehung der späteren kirchlichen Lehrentscheidungen. Deutlicher sollte dabei auch das Problem einer einheitlichen alttestamentlichen Gesamt-Theologie angesprochen werden. Mit einem längeren Zitat aus »Dabru emet« eröffnet er das dritte Kapitel dieses Teils, in dem es um »die volle theologische Anerkennung des Judentums« und das uneingeschränkte »Weiterbestehen des Bundes Gottes mit Israel und der bleibenden Erwählung des jüdischen Volkes« geht. Sehr präzise wird dabei auch die theologische Problematik jeder Art von Judenmission beschrieben – allerdings muss man den Text genau lesen, um diese Perle zu entdecken.
Der dritte Teil macht die »jüdische Bibel als ›Schrift‹ des Neuen Testaments und damit als »vorgegebene und gültige Autorität und Tradition« bewusst. Was der Rezensent bereits 1960 – und damit viel zu früh – erkannte, beginnt sich heute durchzusetzen. Interessant sind die auf S. 94 formulierten Fragestellungen, die hier nicht ausführlich wiedergegeben werden können. Vielleicht sollte man nicht nur davon sprechen, dass, »was sich mit Jesus von Nazareth ereignet,« allein von der »Schrift her seine Geltung und Wertigkeit« erhält, sondern zuallererst seine Deutung! Crüsemann stellt einige »Grundsatzaussagen« bei Matthäus und Paulus zusammen, die »allen späteren christlichen Mustern mit dem Alten Testament umzugehen, widersprechen« und untersucht ihre Bedeutung für die gesamte Fragestellung. Den Eingangssatz des Hebräerbriefs sieht er als Paradebeispiel für seine Missdeutung als »Kronzeugen für die Überlegenheit des Neuen Testamentes über das Alte«. Allerdings scheint er mir diesen Brief hinsichtlich des Verhältnisses zum Alten Testament zu positiv zu bewerten. Anschließend befasst er sich mit unterschiedlich überzeugenden Argumenten mit torakritischen Aussagen des Neuen Testaments. Vielleicht sollte man sie einfach als Meinung bestimmter Richtungen innerhalb der frühen Christenheit verstehen und daher ihre dogmatische Relevanz geschichtlich relativieren. Schwierigkeiten bereiten ihm entsprechende Aussagen des Galaterbriefs. Vielleicht müsste stärker beachtet werden, dass sich Paulus hier nicht grundsätzlich zur Geltung der Tora äußert, sondern zu ihrer Geltung für Nichtjuden! (In dem Kapitel über die »Tora Israels im Zusammenleben von jüdischen und nichtjüdischen Menschen« wird dies deutlicher). Als Folgerung formuliert er: »Es gibt im Neuen Testament […] keine christliche Wahrheit, die nicht – alttestamentlich gewonnen wäre.« Über die Erörterung der griechischen oder hebräischen Bibel als »Schrift« der frühen Christenheit (die er für nicht eindeutig lösbar hält) kommt er schließlich zu der Frage: »Was ist das Neue im Neuen Testament?«. Für Crüsemanns Gründlichkeit spricht, dass er den einzelnen Stellen nachgeht, die im Neuen Testament dafür zu sprechen scheinen, dass das Neue das Alte ablöst. Bemerkenswert ist der Hinweis, dass es sich häufig um Zitate aus dem Alten Testament handelt. Beim Bildwort vom alten und neuen Wein hebt er mit Recht hervor, dass es darum gehe, Verluste zu vermeiden, nicht das Alte abzuwerten. Manches wirkt auch apologetisch, weil er um den Nachweis bemüht ist, die einschlägigen Stellen seien nicht abwertend gemeint. Wirkt hier die stillschweigende Voraussetzung nach, dass biblische Aussagen immer „richtig“ sein müssen, weil sie als dogmatische Grundlage des Glaubens gelten? Sein Hinweis auf das paulinische »noch nicht« führt dabei theologisch wesentlich weiter. Anhand der Begrifflichkeit vom alten und neuen Bund fragt er, ob mit dem Festhalten an diesen biblischen Begriffen auch ihr Sinn transportiert wurde. Wie in der EKD-Studie geht er auf die innerbiblische Bedeutungsgeschichte des Bundesgedankens ein. Bezüglich des Hebräerbriefs tritt er dafür ein, dass er sich zur Bedeutung Jesu für Juden und Jüdinnen äußere und erst bei der Lektüre durch Heidenchristen Kirche und Judenheit einander gegenüberstellt werden. Sehr ausführlich setzt er sich mit 2.Kor 3 auseinander. Sein Verständnis aufgrund der mehr oder weniger eindeutig zitierten alttestamentlichen Texte, muss sich allerdings die Frage gefallen lassen, ob mit den heidenchristlichen Adressaten des Briefes nicht doch der Keim zu deren Enteignung gelegt ist. Zutreffend sind dagegen seine Ausführungen zum »Bund in meinem Blut«; sie sollten von allen, die im Konfirmandenunterricht junge Menschen auf das Abendmahl vorbereiten, zur Kenntnis genommen werden.
Was er über Kirche und Israel angesichts des Begriffs Volk Gottes schreibt, ist allen, die seit Jahren am christlich-jüdischen Gespräch beteiligt sind, längst bekannt, leider aber nur ihnen und sollte dringend von allen darüber hinaus beherzigt werden. Aus dem Kapitel über die Kirche als »Volk Gottes« ist besonders wichtig: »Erst in der Spätzeit des Neuen Testamentes werden zentrale Attribute uneingeschränkt und ungebremst auf die Kirche übertragen.« Man sollte ergänzen: Für Paulus ist die Kirche »Leib Christi«, vermutlich weil er nur Israel als Gottesvolk kennt.
Der vierte Teil behandelt den »Gott der jüdischen Bibel und die Messianität Jesu« und geht dabei zunächst auf die Frage »Erfüllung oder Bestätigung der Schrift« ein. Er geht davon aus, dass ein Verständnis von »Erfüllung« als einem exklusiven Anspruch in einem »gegen die Juden gewendeten grundlegenden Verständnis der Schrift« nicht dem Neuen Testament entspricht. Nach ausführlichen Wort- und Begriffsfeld-Untersuchungen kommt er zu dem Ergebnis: »Erfüllung heißt vollmächtige Inkraftsetzung der Schrift«, andernfalls werde suggeriert, »dass die im Zitat genannten Texte im Sinne prophetischer Ansagen verstanden werden«; man müsste sogar sagen: orakelhafter Ansagen.
Der im Titel des Buches zentrale Begriff »Wahrheitsraum« muss selbstverständlich an zentralen Themen des Neuen Testaments bewahrheitet werden, so z.B. wenn »Auferstehung als Schriftauslegung« bezeichnet wird. (Nicht nur) dieses Kapitel sei allen im Verkündigungsdienst und Religionsunterricht Tätigen dringend zur Lektüre empfohlen; denn hier geht es um ein theologisches Schlüsselthema. Allerdings sollte vielleicht noch stärker auf die Schrift als Deutungshorizont des Jesusgeschehens als auf die lukanische Missionstheorie abgehoben werden. Mit Recht stellt Crüsemann aber (im Unterschied zu vielen heute noch zu hörenden Predigten) bezüglich der Erscheinungserlebnisse der Jünger fest, »diese Erfahrung ist nur deshalb eine Erfahrung von der Auferstehung Jesu, weil sie genau umgekehrt das vorgängig bekannte Zeugnis der Schrift bestätigt.« In gleicher Weise formuliert er im Blick auf die Emmausjünger, »das Vertrauen auf die Botschaft der Propheten ist der Glaube, um den es geht.« – Lesen Sie selbst! – Auch die entsetzlichen Beispiele einer gegenläufigen Hermeneutik. Interessant ist auch die Vorstellung des erhöhten Christus »als messianischer König an der Seite Gottes«. Auch für die Präexistenzchristologie wird der biblische »Wahrheitsraum« aufgezeigt.
Spannend ist die Frage, wie sich das neutestamentliche »Jetzt« in diesen Wahrheitsraum fügt. Die Antwort lautet im Anschluss an Röm 16,25-27: darin komme »etwas ans Licht, eben das Evangelium an die Völker, das vorher durch ewige Zeiten hindurch als Geheimnis verschwiegen worden war.« Ob dies nachpaulinisch sein muss, müsste angesichts derselben Hermeneutik, die sich in Qumran, aber auch in 1.Kor 10,11 und Röm 15,4 (von Crüsemann zitiert) nachweisen lässt, nochmals überprüft werden.
Überhaupt: Ich habe dieses Buch in einem Zug mit Begeisterung gelesen; aber fast möchte ich sagen: Es geht einem wie mit der Bibel, man muss es immer und immer wieder lesen und damit arbeiten. Oder wie es der im Talmud in den Sprüchen der Väter zitierte Ben Bag Bag im Blick auf die Tora ausdrückt: »Wende sie hin, wende sie her, denn Alles ist in ihr; schaue in sie hinein und werde grau und alt in ihr, und von ihr weiche nicht; denn es gibt kein besseres Maß als diese.« Eine Hilfe dazu bietet auch das Bibelstellenregister am Ende des Buches.
Frank Crüsemann: Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Die neue Sicht der christlichen Bibel.
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011
384 Seiten mit 6 farbigen Abbildungen
Euro 29,95
Die Frau hinter dem Schleier
[DER STANDARD (Österreich)]
Abo-Hinweis
Dann abonnieren Sie unsere Seiten oder testen Sie uns vorab mit einem kostenfreien Schnupper-Abonnement!
Abo bestellen
Sie sind bereits Abonnent?
Dann melden Sie sich bitte erst mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an, um die Fundstelle inkl. Quellenangabe und Link sehen und nutzen zu können!
Anmeldung