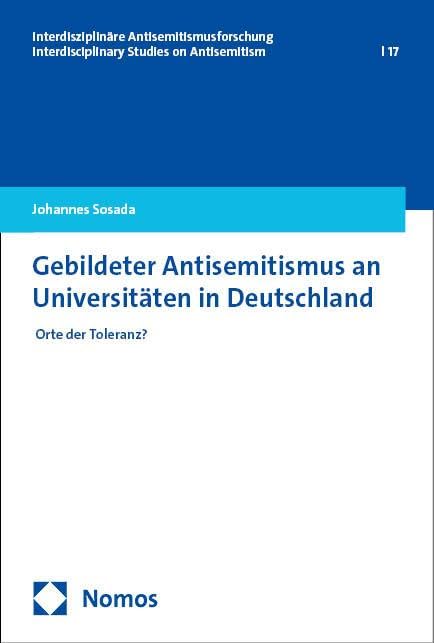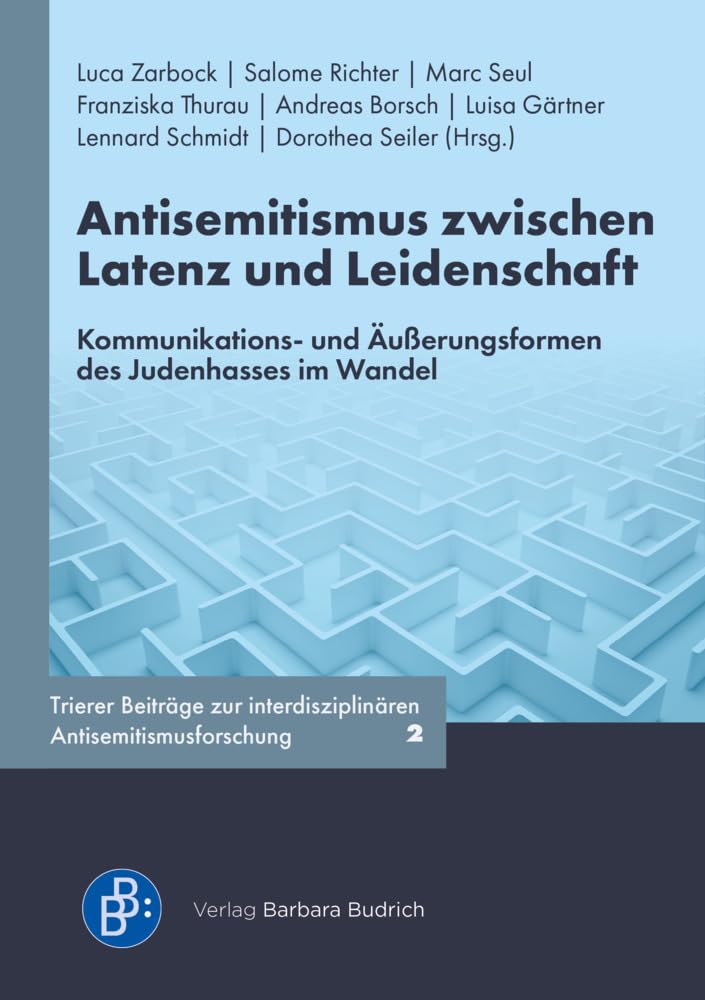ONLINE-EXTRA Nr. 367
© 2025 Copyright bei Autor und Verlag
Zu den errschreckendsten Phänomenen nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Okotber 2023 und dem anschließenden Beginn des Gaza-Krieges gehören sicherlich das Ausmaß antisemitischer, anti-israelischer und propalästinensischer Aktivitäten an den deutschen Hochschulen, die sich nicht selten auch in gewaltsamen Übergriffen gegen jüdische Studierende niederschlugen. Allein an den nordrhein-westfälischen Hochschulen beispielsweise haben sich die Meldungen über antisemitische Vorfälle in 2024 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. "Es gab schon lange ein antisemitisches Grundrauschen in Deutschland", stellte Hannah Veiler, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands (JSUD), in einem Bericht auf TAGESSCHAU.de im Sommer 2024 fest: "Aber das, was wir jetzt an Einschüchterungen, Beleidigungen und körperlichen Angriffen erleben, ist eine antisemitische Welle, die meine Generation in Deutschland noch nicht erlebt hat." Die teils offen und militant zu Tage getretene anti-jüdische, anti-israelische und pro-palästinensische Stimmung im akademischen Milleu war für weite Teile der Öffentlichkeit überraschend.
Kaum verwunderlich, meint wiederum Johannes Sosada, der das akademische Milieu als ein von der Antisemitismusforschung bisher als zu sehr vernachlässigtes Milieu betrachtet. Vor diesem Hintergrund hat er für seine hoch interressante Dissertation auf Basis von 30 Interviews mit Studierenden den Antisemitismus an Universitäten in Deutschland analysiert und nachgezeichnet. Seine Analyse der Interviewgespräche, die seit kurzem als Buch vorliegt ("Gebildeter Antisemitismus an Universitäten in Deutschland: Orte der Toleranz?"; Baden-Baden 2025; nähere Angaben weiter unten) liefert dabei nicht nur Einblicke in die Gedanken- und Gefühlsstrukturen der Studentenschaft, sondern ermöglicht auch erste Rückschlüsse und Erklärungsansätze, was die zahlreichen antisemitischen Vorfälle an Universitäten nach dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel ermöglicht bzw. begünstigt hat.
In einem nicht minder empfehlenswerten Reader ("Antisemitismus zwischen Latenz und Leidenschaft. Kommunikations- und Äußerungsformen des Judenhasses im Wandel"; Leverkusen 2024; nähere Angaben weiter unten) hat Sosada das Problem der Judenfeindschaft in gebildeten Milieus und an den Unviersitäten in einem kurzen Beitrag grundsätzlich skizziert. Nach einem kurzen historischen Abriss erläutert er anhand zweier Vorfälle aus dem Jahr 2016 exemplarisch die Kontinuitäten des gebildeten Antisemitismus und verweist zugleich darauf, wie sehr dieser als bislang blinder Fleck der Antisemitismusforschung gelten muss. Sein Beitrag ist nachfolgend wiedergegeben: "Gebildeter Antisemitismus an Universitäten in Deutschland".
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass beide oben erwähnten Bände - Sosadas Dissertation und der genannte Reader - als eBook Open Access Versionen kostenfrei zugänglich sind. Informationen und Links dazu in den beiden Anzeigen weiter unten.
online für ONLINE-EXTRA
Lizens CC BY 4.0
Online-Extra Nr. 367
1 Einleitung
Mit dem Terrorüberfall der Hamas am 07. Oktober 2023 kam es deutschlandweit zu einem Ausbruch antisemitischer Vorfälle: Jüdinnen und Juden wurden auf offener Straße physisch angegriffen oder beschimpft, es gab Angriffe auf jüdische Einrichtungen und auf zahlreichen Demonstrationen wurde Antisemitismus dokumentiert. Im öffentlichen und gesellschaftlichen Diskurs zeigte man sich besonders über die Ereignisse an deutschen Universitäten schockiert. An verschiedenen Hochschulen kam es zu antisemitischen Vorfällen wie Schmähgesängen, Protestaktionen oder auch tätlichen Angriffen. An der FU Berlin wurden jüdische Studierende daran gehindert, einen Hörsaal zu betreten, in Leipzig wurden antisemitische Transparente an ein Hörsaalgebäude gehängt, in Frankfurt und Düsseldorf wurden antisemitische Parolen geschrien. Jüdische Studierende und jüdische Organisationen berichteten nicht nur von Drohungen, sondern auch von tätlichen Angriffen (vgl. Gebhard/Klaus 2023). In Berlin wurde ein jüdischer Student von einem Kommilitonen so schwer zusammengeschlagen, dass er schwerverletzt ins Krankenhaus musste (vgl. Jüdische Allgemeine 2024). Allein für den ersten Monat nach dem Terrorüberfall der Hamas meldete die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) deutschlandweit 71 antisemitische Vorfälle an Bildungseinrichtungen (RIAS 2023: 9). Die deutsche Öffentlichkeit und Berichterstattung reagierte schockiert und ratlos ob der Ursache. Konsequenzen wie Sanktionierungen und andere, weiterführende Maßnahmen der Hochschulen, um vergleichbare Vorfälle in Zukunft zu verhindern, wurden gefordert.
Diese aktuellen antisemitischen Vorfälle an Universitäten und die aufkeimende Debatte sollten jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass Antisemitismus schon immer dem gebildeten Milieu und insbesondere auch den Universitäten inhärent war und ist. Historisch, aber auch aus der jüngeren Vergangenheit, lassen sich zahlreiche Beispiele heranziehen, welche die Virulenz von Antisemitismus an deutschen Universitäten verdeutlichen. Umfangreichere Forschung gibt es hierzu bisher allerdings kaum, was zuletzt auch der vom Deutschen Bundestag eingesetzte „Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus“ bemängelte (vgl. Deutscher Bundestag 2017: 234f.). Die britische Juristin und Hochschullehrerin Ruth Deech verbildlichte vor einigen Jahren die herausgehobene Relevanz von Antisemitismus an Universitäten und bezeichnete diese als „Kanarienvogel im Kohlebergwerk“ (zit. nach Weale 2017), also ein gesellschaftliches Frühwarnsystem. Mit anderen Worten: Wenn sich Antisemitismus an Universitäten intensiviert, so besteht die Gefahr, dass dieser in der gesamten Gesellschaft zunimmt.
Im vorliegenden Beitrag soll daher ein Überblick über Antisemitismus an Universitäten in Deutschland gegeben werden. Hierfür wird zunächst gezeigt, dass Antisemitismus gerade in Bildungseliten schon immer virulent war und ist. Darauf aufbauend wird das Konzept des Gebildeten Antisemitismus erläutert und gezeigt, dass Antisemitismus an Universitäten in Deutschland nicht nur in der Historie bereits stark ausgeprägt war, sondern auch, dass Universitäten oft ‚Vorreiter‘ bei der Verbreitung antisemitischen Gedankengutes waren. Anschließend wird entlang zweier beispielhafter Vorfälle von Antisemitismus an deutschen Universitäten in den letzten Jahren gezeigt, wie sich Antisemitismus an Universitäten bis zu den aktuellen Vorfällen nachzeichnen lässt.
2 Kurzer historischer Abriss: Judenfeindschaft in gebildeten Milieus und an Universitäten
Die jahrtausendealte Geschichte der Judenfeindschaft ist insgesamt breit und gut erforscht (siehe u.a. Bauer 1992; Laqueur 2006; Poliakov 1985; Schwarz- Friesel/Reinharz 2013). Entsprechend ist auch der Antisemitismus in gebildeten Milieus dokumentiert. Mit Fokus auf Antisemitismus in gebildeten Schichten ist zunächst die Rolle der Kirchen, die über Jahrhunderte die Bildungseliten in Europa stellten und ausbildeten, hervorzuheben. Frühchristliche Vertreter, wie Augustinus und Chrysostomos oder später Luther, haben als Gelehrte früh dazu beigetragen, antisemitisches Gedankengut in weite Teile der Gesellschaft zu tragen (vgl. Bauer 1992; Botsch 2014; Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 58ff.). In Deutschland wird Antisemitismus in gebildeten Schichten dann vor allem im späten 18. und 19. Jahrhundert dokumentiert. In dieser Zeit wurden unzählige antisemitische Schriften publiziert – oft durch Universitäten oder Universitätsangehörige. Genannt sei bspw. das Pamphlet Talmudjuden des Professors August Rohling von 1871, in dem dieser Juden das Streben nach Weltherrschaft und eine besondere Grausamkeit und Verdorbenheit unterstellte (vgl. Grundmann 2015). Wenige Jahre später, 1879, wird die Salonfähigkeit von Antisemitismus im gebildeten Bürgertum während des Berliner Antisemitismusstreites besonders deutlich: Wilhelm Marr veröffentlichte das Propagandapamphlet Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum – Vom nichtconfessionellen Standpunkt aus betrachtet und gründete die Antisemitenliga, womit er maßgeblich den Begriff ‚Antisemitismus‘ prägte (vgl. Krieger 2002; Volkov 2006: 22f.). Der damals angesehene Historiker Heinrich von Treitschke oder der Hof- und Domprediger Adolph Stoecker schlossen sich den antisemitischen Ausführungen Marrs an und fabulierten in ihren Schriften über die angebliche Vormachtstellung der Juden, wofür sie wiederum von Professoren wie Theodor Mommsen kritisiert wurden. Das Ausmaß von Antisemitismus unter Studenten in dieser Zeit verdeutlichen bspw. die Bücherverbrennungen rund um das Wartburgfest 1817. Dabei verbrannten Burschenschaftler das Buch Germanomanie des jüdischen Publizisten Saul Ascher, in dem dieser u.a. die Konstruktion von Juden als ‚Fremde‘ kritisierte (vgl. Treß 2011: 434 f.). Es lassen sich für die Verbreitung von Antisemitismus im gebildeten Milieu in dieser Zeit zahlreiche weitere Beispiele anführen: Ob Philosophen wie Kant, Hegel oder Fichte, Dichter wie Fontane, oder Komponisten wie Wagner – sie alle haben in ihren Werken antisemitisches Gedankengut verbreitet (siehe ausführlich bspw. Hentges 2009; Nirenberg 2015: 389ff.; Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 58ff.).
Im frühen 20. Jahrhundert, insbesondere in der Zeit zwischen den Weltkriegen 1918 bis 1939, spitzte sich die Situation für Juden in gebildeten Kreisen weiter zu. Antijüdische Diskriminierung, wie auch physische Angriffe waren an Universitäten in Deutschland (aber auch europaweit) alltäglich (vgl. Schwarz-Friesel 2016). Für die Zeit des Nationalsozialismus dokumentieren zahlreiche Ereignisse, Berichte und Studien die tiefe Verankerung antisemitischen Gedankengutes im akademischen Milieu.1 An den Universitäten wurden binnen kürzester Zeit jüdische Wissenschaftler:innen und Studierende entfernt, ihre Bücher öffentlich verbrannt und die Universitäten für ‚judenfrei‘ erklärt. Hervorzuheben ist, dass dies bei Dozent:innen und Studierenden kaum auf Widerspruch stieß, sondern vielmehr auf (begeisterte) Zustimmung (vgl. Benz 2013). Denn gerade an Universitäten wurde damals das nationalsozialistische Weltbild gefestigt, weitergedacht und verbreitet.
Mit dem Ende der NS-Diktatur wurden offiziell alle Personen mit NS-Vergangenheit von Universitäten ausgeschlossen. Wie in vielen anderen Bereichen (Öffentlicher Dienst, Justiz, Sicherheitsdienste etc.) wurde diesem Anspruch nur äußerst unzureichend entsprochen. Ehemalige NSDAP-Mitglieder und Sympathisant:innen des NS-Regimes konnten ihre Stellung behalten, wurden wiedereingesetzt oder wechselten lediglich den Lehrstuhl oder die Universität. Eine echte Aufarbeitung der NS-Zeit fand im universitären Bereich nicht statt (vgl. Benz 2013; Wildt 2012). Antisemitisches Gedankengut und Narrative aus der Zeit des Nationalsozialismus wurden somit auch nach 1945 an Universitäten weiterverbreitet, wenn auch ohne staatliche Förderung, verdeckter und weniger aggressiv. Erst in den 1980er Jahren, als ein Großteil der vor 1945 tätigen Professor:innen verstorben oder emeritiert war, fingen erste Universitäten in Westdeutschland an, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten (vgl. Friedmann 2006).
Zuletzt ist die Verbreitung von Antisemitismus unter Gebildeten besonders auf den Demonstrationen gegen die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dokumentiert (vgl. u.a. Klein 2022; Sosada 2022; Sosada 2020). Viele der Organisator:innen, die sich antisemitisch äußerten, sind hochgebildet und haben akademische Titel.2 Für die jüngere Vergangenheit lassen sich zudem zahlreiche Debatten im akademischen Milieu anführen, welche die gegenwärtige Verbreitung von Antisemitismus in gebildeten Bevölkerungsschichten verdeutlichen: Die Paulskirchenrede Martin Walsers 1998, die Äußerungen des ehemaligen Vizekanzlers und FDP-Politikers Jürgen Möllemanns 2002, Günther Grass’ Gedicht Was gesagt werden muss 2012, die Beschneidungsdebatte 2012, die Augstein-Debatte 2013, die Debatte um Achille Mbembe 2020 oder um die documenta in Kassel 2022.
Der Autor untersucht ein in der Antisemitismusforschung bisher vernachlässigtes Milieu und eine viel zu wenig beachtete Gruppe: Auf Basis von 30 Interviews mit Studierenden wird Antisemitismus an Universitäten in Deutschland analysiert und nachgezeichnet. Die Analyse der Interviewgespräche liefert dabei nicht nur Einblicke in die Gedanken- und Gefühlsstrukturen der Studentenschaft, sondern ermöglicht auch erste Rückschlüsse und Erklärungsansätze, was die zahlreichen antisemitischen Vorfälle an Universitäten nach dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel ermöglicht bzw. begünstigt hat.
3 Gebildeter Antisemitismus
Mit Blick auf die lange Historie gebildeter Judenfeindschaft muss Antisemitismus als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen begriffen werden, das über alle sozialen Grenzen hinweg auftritt (siehe bspw. Schwarz-Friesel 2015; Schwarz-Friesel/Friesel/Reinharz 2010; Salzborn 2019). Antisemitismus sollte nicht auf politische Ränder reduziert und so marginalisiert werden (vgl. Bernstein 2018: 23ff.; Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 103). Vielmehr ist Antisemitismus unter Gebildeten<referenz 3> sogar besonders stark ausgeprägt, wie der Historiker Michael Wolffsohn treffend feststellte: „Die vermeintliche Bildungs- und Geisteselite zählte oft zu den antisemitischen Vorreitern“ (Wolffsohn 2020: 232).
Die Besonderheit und gleichzeitig zentrale Herausforderung des heutigen Gebildeten Antisemitismus liegt darin, diesen zu detektieren und zu sanktionieren, da er nicht offen und direkt kommuniziert wird. Mit dem Zusammenbruch des NS-Regimes und nach dem Holocaust wird offen artikulierter Antisemitismus in der (politischen) Öffentlichkeit sozial geächtet, tabuisiert und möglicherweise geahndet. In der Forschung unterliegt Antisemitismus daher wesentlich dem Effekt der sozialen Erwünschtheit. Damit wird das Phänomen beschrieben, demnach sich Personen so äußern, wie es der sozialen und gesellschaftlichen Norm entspricht. Insbesondere in Deutschland und gerade unter Gebildeten ist dieser Effekt mit Blick auf Antisemitismus als besonders hoch einzuschätzen (vgl. Bernstein 2018: 271f.; Deutscher Bundestag 2017: 259f.; Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 9f.; Salzborn 2014: 123f.). Studien zeigen zudem, dass der Einfluss des Phänomens der sozialen Erwünschtheit mit dem Bildungsgrad steigt (vgl. Zick 2021: 59, 97 f.).4 Höher Gebildete können besonders gut einschätzen, was man sagen darf und was besser nicht, genauso wie sie auch aufgrund ihrer oftmals höheren Stellung besonders von einer möglichen Sanktionierung (gesellschaftliche oder juristische Konsequenzen) betroffen wären. Expert:innen schätzen den Antisemitismus von Gebildeten aufgrund seines persuasiven Potenzials und manipulativen Charakters langfristig als gefährlicher und einflussreicher ein als den Vulgär-Antisemitismus von Extremist:innen (Schwarz-Friesel 2015: 21). Von Gebildeten (re-)produzierter Antisemitismus erhält einen ‚akademischen Anstrich‘ und wirkt damit vermeintlich seriös und sozial tragbar. Die Verwendung gehobener Sprache, komplexer Sätze und von Fachbegriffen erschwert die Aufdeckung und Entschlüsselung von Antisemitismus zusätzlich (vgl. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 112ff.). Gleichzeitig haben viele Menschen Respekt und Vertrauen in Personen in höheren, angesehenen Positionen oder in akademische Titel, wodurch auch der artikulierte Antisemitismus ein wesentlich größeres Akzeptanzpotenzial aufweist.
Schwarz-Friesel und Reinharz haben in ihrer Studie Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert wesentliche Charakteristika und Argumentationsmuster des Gebildeten Antisemitismus herausgearbeitet (vgl. Schwarz- Friesel/Reinharz 2013). Sie unterscheiden dabei zwischen Legitimierungs-, Vermeidungs-, Rechtfertigungs-, Relativierungs- und Abgrenzungsstrategien (ebd. 346 ff.). Mit den Strategien der Re-Klassifizierung und der Umdeutung kommen zwei spezifischere Formen von Relativierungsstrategien hinzu (vgl. Schwarz-Friesel 2015: 299ff.). Durch die Verwendung dieser Strategien versuchen Gebildete vor allem dem Vorwurf des Antisemitismus vorzubeugen bzw. diesen zu entkräften (Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 295). In ihren Äußerungsformen treten die Strategien parallel und verschachtelt auf und sind damit nicht immer trennscharf voneinander zu unterscheiden.
Neben diesen charakteristischen Argumentationsmustern wurden in weiteren Veröffentlichungen (siehe insb. Schwarz-Friesel 2015a) verschiedene weitere Merkmale des Gebildeten Antisemitismus ausgeführt und weiter beschrieben. Antisemitische Einstellungen werden von Gebildeten demnach über Umwege und mittels Camouflage-Techniken verbalisiert (vgl. Schwarz-Friesel 2015b). Wie charakteristisch für den Post-Holocaust- oder Israelbezogenen Antisemitismus werden tief in der Gesellschaft verwurzelte klassische Stereotype bspw. über den Holocaust (wie durch Verharmlosung oder Leugnung) oder Israel geäußert. Antisemitismus wird „rekodiert und verschlüsselt“ (ebd.), zum Beispiel durch die Nutzung von Chiffren (vgl. Rensmann 2015). So vermeiden Antisemit:innenn bspw. die Verwendung des Wortes ‚Jude’ und nutzen stattdessen Begriffe wie ‚Zionist‘ oder ‚Israel‘ (ebd. 96). Insbesondere ein massiver Antiisraelismus ist für die Argumentation gebildeter Antisemit:innen kennzeichnend. Dieser wird dabei nicht plump, vulgär und offen kommuniziert, sondern vielmehr unterschwellig, bspw. in Form eines ‚moralischen‘ Antisemitismus bspw. im Gewand der ‚Kritik an Israel‘ (Schwarz-Friesel 2019: 41). Zugleich wird häufig das Motiv des Kritiktabus bzw. des Meinungsdiktates herangezogen oder die ‚Antisemitismuskeule‘, mit der Antisemit:innen sich selbst als Opfer darstellen (vgl. Schwarz-Friesel 2015: 303). Charakteristisch ist ferner die Verwendung von NS-Vergleichen und Referenzen genauso wie die Schlussstrichforderung, die bei Gebildeten besonders stark ausgeprägt ist (vgl. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 147). Mit den Kennzeichen der hohen Emotionalisierung und eines hyperbolischen Sprachgebrauches kommen zwei weitere Merkmale hinzu, die bei Gebildeten Antisemit:innen besonders ausgeprägt sind (ebd. 226f.; 249f.).
4 Vorfälle an Universitäten
Basierend auf der dargestellten Virulenz von Antisemitismus im gebildeten Milieu sowie dem Konzept des Gebildeten Antisemitismus und seiner Kennzeichen sollen im Folgenden beispielhaft Vorfälle an Universitäten in Deutschland aus den letzten Jahren analysiert werden. Es wird demonstriert, dass mit der eingangs geschilderten Aktualität zwar eine neue Dimension erreicht wurde, Antisemitismus an Universitäten in Deutschland aber seit Jahren virulent ist und sich dieser eindeutig entlang der Kennzeichen des Gebildeten Antisemitismus nachzeichnen lässt. Im Folgenden werden daher exemplarisch zwei Vorfälle, ein Seminar an der HAWK-Hildesheim und die „Nakba-Wanderausstellung“ in Göttingen, näher beleuchtet.
4.1 HAWK-Hildesheim 2016: Das Seminar „Soziale Lage der
Jugendlichen in Palästina“
In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland immer wieder Fälle, bei denen Lehrveranstaltungen in die öffentliche Diskussion gerieten. Meist wurde die öffentliche Diskussion dadurch ausgelöst, dass Seminarinhalte, vom Lehrpersonal getätigte Aussagen oder vermittelte Inhalte als antisemitisch kritisiert wurden. Die verschiedenen Vorfälle sind dabei unterschiedlich gut dokumentiert. Dies variiert je nach Dokumentations- bzw. Beweislage, sonstiger vorherrschender Berichterstattung und damit verknüpftem öffentlichem und journalistischem Interesse. Generell ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Ein breit rezeptierter Vorfall war die im Jahr 2016 geführte Debatte um ein an der HAWK (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst) Hildesheim angebotenes Seminar mit dem Titel „Soziale Lage der Jugendlichen in Palästina“. In dem von einer Dozentin über viele Jahre angebotenen Seminar wurde Israel dabei nicht nur einseitig und plakativ negativ dargestellt, sondern auch eindeutig antisemitisches Unterrichtsmaterial verbreitet, ohne dieses adäquat einzuordnen oder zu kontextualisieren. Beispielsweise wurde im Lehrmaterial über Organdiebstahl und Folter durch die israelische Armee berichtet oder das Stattfinden eines von Israel durchgeführten Völkermordes an der palästinensischen Bevölkerung propagiert. Obwohl es bereits Jahre zuvor Beschwerden seitens Studierender gab, wurde das Seminar jahrelang von der Hochschulleitung als unproblematisch eingestuft (vgl. Dillmann 2016a; Dillmann 2016b; Posener 2016a).
An die breite Öffentlichkeit gelangte der Fall, als eine angefragte externe Gastdozentin (selbst jüdischen Glaubens) Kritik am Seminarinhalt übte und die Universitätsleitung dies als „persönliche Empfindlichkeit“ (zit. nach Dillmann 2016b) abtat. Die Gastdozentin wandte sich daraufhin an den Zentralrat der Juden in Deutschland und gemeinsam mit diesem an das Niedersächsische Kultusministerium. Da eine Antwort des Ministeriums zunächst ausblieb, wurde die Amadeu Antonio Stiftung mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt (vgl. Dillmann 2016b, Posener 2016a). Im Ergebnis attestierte dieses dem Seminar eine massive Unwissenschaftlichkeit. Die Auswahl der Materialien würde Israel in einer „delegitimierenden bis antisemitischen Betrachtungsweise“ (zit. nach Dillmann 2016b) behandeln und ein antisemitisches Weltbild vermitteln. Die Hochschulleitung der HAWK erklärte daraufhin, der Zentralrat wolle die Freiheit und Lehre der Forschung an der HAWK einschränken, woraufhin der Fall in der Jüdischen Allgemeine veröffentlicht wurde (vgl. Dillmann 2016a, Posener 2016a). Anschließend wurde der Fall in verschiedenen überregionalen wie auch internationalen Medien aufgegriffen (vgl. bspw. Dillmann 2016b; Posener 2016a, oder Weinthal 2016). Das Gutachten der Amadeu Antonio Stiftung wurde von der Universitätsleitung in der anschließenden öffentlichen Debatte als „fragwürdig“ (zit. n. Jacobs 2016) abgelehnt. Das Niedersächsische Wissenschaftsministerium, welches das Gutachten ebenfalls ablehnte, beauftragte ein weiteres Gutachten, um die Seminarinhalte zu prüfen (vgl. Posener 2016b).
Das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, welches mit dem zweiten Gutachten beauftragt war, kam zu dem Schluss, dass das unterrichtete Seminar „einseitig, unwissenschaftlich und in dieser Form an einer deutschen Hochschule nicht tragbar“ (Zentrum für Antisemitismusforschung 2016: 1) sei. Im Unterrichtsmaterial fänden sich Texte, die „mit antisemitischen Klischees und Unterstellungen arbeiten“ (ebd.: 2). Die HAWK entschied daraufhin, das Seminar nicht länger anzubieten und der verantwortlichen langjährigen Dozentin keinen Lehrauftrag mehr zu erteilen. Zudem trat die zuständige Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit zurück5 und der Präsidentin der HAWK wurde das Vertrauen entzogen, indem sie nicht für eine zweite Amtszeit nominiert wurde und damit wenig später als Präsidentin ausschied (vgl. Meyer-Schilf 2017).
Der dargestellte Fall an der HAWK Hildesheim veranschaulicht beispielhaft die Brisanz und großen Probleme im Umgang mit antisemitischen Einstellungen an Universitäten in Deutschland. Zunächst sind die zeitliche Dimension und der Umgang mit der geäußerten Kritik hervorzuheben. Das Seminar an der HAWK wurde seit 2006, also zehn Jahre lang, angeboten. Hunderte Studierende haben das Seminar besucht, womit ihnen im Rahmen ihrer universitären Ausbildung antisemitische Stereotype vermittelt wurden. Obwohl es auch stetig Kritik seitens der Studierenden gab, wurde diese von der Hochschulleitung ignoriert und das Seminar weiter in unveränderter Form angeboten. So vermittelte die Hochschuldirektion bei den Studierenden den Eindruck, dass ihre Kritik nicht gerechtfertigt und die Seminarinhalte legitim und korrekt seien. An diesem Beispiel lassen sich zahlreiche Formen der im vorherigen Kapitel dargestellten Text- und Argumentationsstrategien nachzeichnen.
Zunächst wurde die geäußerte Kritik der jüdischen Gastdozentin seitens der Hochschule nicht ernst genommen, sondern als „persönliche Empfindlichkeit“ (zit. n. Flesch 2016) abgetan, womit das eigene Vorgehen legitimiert und die Kritik der Dozentin relativiert wurde. Um das eigene Vorgehen zu rechtfertigen und das positive Selbstbild aufrechtzuerhalten, verwies die Hochschulleitung in ihrer Antwort an die Gastdozentin zudem auf „vielfältige und herzliche Austauschbeziehungen zu israelischen Hochschulen, Kolleginnen und Kollegen“ (zit. nach Dillmann 2016a). Der Aufbau bzw. die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes sind dabei typische Merkmale von Legitimierungs- und Vermeidungsstrategien (vgl. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 351ff.). Der Verweis auf die Beziehungen der HAWK zu Israel kann als Kennzeichen einer Rechtfertigungsstrategie gesehen werden. Durch die Diskreditierung und Infragestellung des Gutachtens der Amadeu Antonio Stiftung werden zudem die Strategien der Relativierung und Vermeidung genutzt. Verantwortung wurde lieber vehement von sich gewiesen, anstatt ein eigenes Fehlverhalten in Betracht zu ziehen und sich zu entschuldigen.
Dass insbesondere bei der Universitätsleitung ein äußerst problematisches Verhalten bzgl. Antisemitismus vorherrschte, wurde unübersehbar, nachdem diese von der Zeitung Die Welt mit den Vorwürfen konfrontiert wurde. So sprach die Leitung von „ziemlich einflussreichen Kreisen“ (zit. n. Posener 2016a), die mit einer „Hasskampagne“ das „Wort verbieten“ und verhindern wollen, dass „unterschiedliche Sichtweisen zu diesem Konflikt an unserer Hochschule zu Wort kommen dürfen“ (zit. n. Flesch 2016). Hier wird nicht nur das für den Gebildeten Antisemitismus typische Motiv des Kritiktabus formuliert, sondern auch das Stereotyp einer jüdischen Verschwörung aktiviert. Zudem beriefen sich Verantwortliche mehrfach auf „die Freiheit der Lehre und Forschung“ (zit. n. Flesch 2016), was als Legitimierungs- und Vermeidungsstrategie gesehen werden kann. Es kann in diesem Fall also eindeutig nachgewiesen werden, dass die Verbreitung antisemitischer Inhalte camoufliert und unter dem Deckmantel der freien wissenschaftlichen Lehre weiter betrieben werden sollte.
Der Fall an der HAWK Hildesheim ist dabei kein Einzelfall, sondern steht vielmehr sinnbildlich für viele vergleichbare Fälle an Universitäten in Deutschland. Bspw. kam es bereits kurze Zeit später, im Jahr 2017, zu einem vergleichbaren Fall an der FU Berlin. Die Dozentin eines Seminars bezeichnete in ihrem eigenen Blog Israel als Apartheid- und Kolonialstaat, war in einem israelfeindlichen Rap-Video zu sehen und unterstützte offen die BDS-Bewegung (vgl. Weinthal 2017). 2022 geriet eine Dozentin an der HU Berlin in die Schlagzeilen, als sie über ihren Twitter-Account den Holocaust relativierende Aussagen verbreitete (vgl. Geiler 2022). In diesen beiden Fällen waren die Reaktionen (auch der Hochschulleitungen) mit jenem im Falle der HAWK Hildesheim vergleichbar und vorwiegend von Relativierung, Rechtfertigung und Vermeidung gekennzeichnet.
Es ist davon auszugehen, dass diese von den Medien aufgegriffenen und dokumentierten Fälle lediglich einen Anhaltspunkt für die tatsächliche Anzahl vergleichbarer Fälle liefert und die Dunkelziffer als hoch einzuschätzen ist. Diese Annahme scheint sich bestätigen zu lassen, da bereits eine oberflächlichen Onlinerecherche oder auch Gespräche mit bspw. Vertreter:innen der Jüdischen Studierenden Union eine deutschlandweit höhere Fallanzahl untermauern.
Antisemitismus als leidenschaftliche Welt(um-)deutung findet nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 über den Kreis der „üblichen Verdächtigen“ im Rechtsextremismus hinaus Anklang. Der Band zeigt die Persistenz, Wandelbarkeit und globale Verbreitung judenfeindlicher Vorstellungen und Äußerungsformen auf und verfolgt sie von der Antike bis in die Telegram-Chats, Universitätshörsäle und Kultureinrichtungen der Gegenwart.
4.2 Universität Göttingen 2016: Die Wanderausstellung zur ‚Nakba‘
Neben Vorfällen und Debatten um Vorlesungen und Seminare stehen immer wieder auch geplante oder durchgeführte Universitätsveranstaltungen im Fokus, bei denen ein israelfeindliches und Antisemitismus beförderndes Weltbild vermittelt wird.
Deutschlandweit führt eine Wanderausstellung mit dem Titel „Die Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948“ immer wieder zu intensiven Debatten. Die vom pro-palästinensischen Verein „Flüchtlingskinder im Libanon“ organisierte Ausstellung wird seit 2008 in zahlreichen europäischen und deutschen Städten an öffentlichen Orten wie Schulen, Kirchen oder Universitäten gezeigt (vgl. Homepage des Vereins Flüchtlingskinder im Libanon e.V.). Die Ausstellung hat dabei immer wieder starke Kritik auf sich gezogen. So wird neben massiver Einseitigkeit und Unwissenschaftlichkeit die Verdrehung und Auslassung historischer Begebenheiten kritisiert, welche antisemitischen Stereotype Vorschub leiste. Es wird bspw. insinuiert, die Staatsgründung Israels habe auf ethnischen Säuberungen basiert (siehe u.a. AJC 2016). Die Ausstellungen wurden immer wieder von Wissenschaftler:innen und Personen des öffentlichen Lebens kritisiert, wie bspw. vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein (vgl. Niewendick 2018).
Im November 2016 sollte die Ausstellung an der Universität Göttingen gezeigt werden, begleitet durch eine Vortragsreihe mit dem Titel „Naher Osten – ferner Frieden?“. Als Vortragende waren u.a. Udo Steinbach und Rolf Verleger geladen, die beide bereits in der Vergangenheit für israelfeindliche und Antisemitismus Vorschub leistende Äußerungen kritisiert wurden (vgl. u.a. Moscovici 2006 und Wuliger 2014). Der Fachschaftsrat Sozialwissenschaften der Universität Göttingen beanstandete in einem offenen Brief sowohl die Ausstellung als auch die Vortragsreihe und forderte, beides abzusagen (vgl. Fachschaftrat Sozialwissenschaften der Universität Göttingen 2016). Die Universitätsleitung verschob daraufhin die Ausstellung und gab eine „externe wissenschaftliche Analyse“ (zit. n. Schlegel 2016) in Auftrag. Die Organisatoren wiederum verlegten den Veranstaltungsort vom Universitätsgelände in eine Göttinger Galerie, sodass Ausstellung und Vortragsreihe wie geplant gezeigt bzw. gehalten werden konnten (vgl. Seminar für Arabistik / Islamwissenschaft II 2016).
Ähnlich wie bei der Debatte um das Seminar an der HAWK-Hildesheim ist auch in Göttingen zunächst die zeitliche Dimension und der Umgang mit der aufkommenden Kritik an Ausstellung und Vortragsreihe hervorzuheben. Nicht nur fand die Ausstellung bereits zuvor an anderen Orten statt, sondern sie wurde trotz der Debatte in Göttingen auch an anderen Universitäten – bspw. am Institut für Arabistik und Islamwissenschaften an der Universität Münster 2019 oder am Centrum für Nah- und Mittelost-Studien der Universität Marburg 2023 – ausgestellt. Über Jahre wurde und wird noch immer Studierenden somit das mit der Ausstellung konnotierte einseitige, antiisraelische und antisemitischen Stereotype Vorschub liefernde Narrativ vermittelt. Die Tatsache, dass die Ausstellung einerseits in Universitäten und andererseits auch an anderen öffentlichen Orten wie Büchereien, Kirchen oder Gemeindehäusern ausgestellt wird, verleiht der Ausstellung Legitimität und Glaubwürdigkeit. Trotz wiederholter, massiver Kritik wurde auf diese stets kaum oder nur äußert unzureichend eingegangen (vgl. u.a. American Jewish Commitee 2016, Deutsch Israelische Gesellschaft Region Stuttgart 2019 und Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern 2014). Die Reaktionen der Veranstalter:innen sind mit jenen des HAWK-Hildesheim-Beispiels vergleichbar. Statt die Kritik ernst zu nehmen, sich adäquat damit auseinanderzusetzen und Konsequenzen zu ziehen, wurde sich auf die „Verteidigung der Meinungsfreiheit“ (vgl. Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V. 2016) oder die „Wissenschaftsfreiheit“ (Ambos 2016) berufen. Solche Aussagen sind für Legitimierungs- und Vermeidungsstrategien beispielhaft. Zusätzlich klingt auch das Motiv des ‚Kritiktabus‘ an. Die Veranstalter:innen haben sich im Sinne der Rechtfertigungsstrategie im Laufe der Debatte auch immer wieder auf vorgeblich anerkannte (jüdische) Autoritäten bezogen. So wurde im Zuge der Debatte bspw. immer wieder betont, dass sich die Ausstellung in zentralen Aspekten auf die Arbeiten jüdischer/israelischer Historiker wie Ilan Pappé stützt. Dass Pappé in der Forschung eine recht isolierte Einzelmeinung darstellt, seine Thesen umstritten und auch in weiten Teilen widerlegt wurden (vgl. u.a. Morris 2011 und Yossi 2011), findet keine Berücksichtigung. In diesem Zusammenhang ist auch die Einladung des deutsch-jüdischen Professors Rolf Verlegers zu sehen, der für seine israelfeindliche Haltung vielfach kritisiert wurde (vgl. u.a. Friesel 2015, Glöckner 2015: 88, Pfeifer 2009). Schließlich wurde in der Kontroverse mit dem „Verweis auf Andere“ (vgl. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 372ff.) auch intensiv ein Merkmal von Rechtfertigungsstrategien genutzt. So wurde argumentiert, dass die Ausstellung bereits an anderen renommierten Orten gezeigt worden war, wie im Schottischen Parlament in Edinburgh, im Palast der Vereinten Nationen in Genf oder im Europäischen Parlament in Straßburg (siehe u.a. Stridde 2021).
Genau wie das Seminar an der HAWK-Hildesheim steht auch der skizzierte Fall um die geplante Nakba-Ausstellung an der Universität Göttingen beispielhaft für zahlreiche weitere universitäre Veranstaltungen, die keine so intensive mediale Berichterstattung erfahren haben. Anhand geladener Redner:innen und Gäste bei Veranstaltungen an Universitäten lassen sich zahlreiche weitere ähnliche Debatten rekonstruieren, wie bspw. an der Universität Leipzig 2005, Bonn 2007 oder Heidelberg 2019. Insbesondere die antisemitische BDS-Bewegung ist verantwortlich für zahlreiche Vorfälle Zusammenhang mit Universitäten. An den Universitäten in den USA trägt die Bewegung maßgeblich zu einem judenfeindlichen Klima auf dem Campus bei (vgl. Elman 2020 oder Gansinger 2018); dies muss jedoch an anderer Stelle analysiert werden.
5 Fazit: Kontinuität und blinder Fleck
Anhand der beiden dargestellten und analysierten Fälle an der HAWK-Hildesheim und der Universität Göttingen wurde beispielhaft gezeigt, dass es bereits vor den Ereignissen des 7. Oktober 2023 Vorfälle von und Debatten um Antisemitismus an Universitäten in Deutschland gegeben hat. Bei einer tiefergehenden Analyse vor dem Hintergrund des Konzepts des Gebildeten Antisemitismus wird dabei deutlich, dass hierbei zahlreiche bekannte Argumentationsmuster und Strategien Anwendung finden. So wurde Antisemitismus in beiden Ereignissen konsequent verharmlost, relativiert und gerechtfertigt. Zudem weisen die Fälle auf ein strukturelles Problem an Universitäten hin: Antisemitische Vorfälle werden verharmlost oder vertuscht und geäußerte Kritik lange nicht wahr- oder ernst genommen. Eine ernste Reaktion auf Vorkommnisse scheint erst dann zu erfolgen, wenn der Druck durch die mediale Berichterstattung zu groß wird. Diese Beobachtung deckt sich dabei mit einem generellen Wahrnehmungsproblem von Antisemitismus im gebildeten Milieu, wie es in den letzten Jahren anhand zahlreicher Antisemitismusdebatten, wie jener um die Äußerungen des Philosophen Achille Mbembe 2020 oder die documenta 15 2022 in Kassel, deutlich wurde. Eindeutig antisemitische Aussagen, Ereignisse oder auch Engagements werden von Akademiker:innen (oft in der Öffentlichkeit wie in Talkshows oder den Feuilletons großer Zeitungen) zunehmend vehement verteidigt, gerechtfertigt und relativiert (siehe u.a. Wiemann 2023).
Die Kombination aus der eingangs dargestellten historischen Verankerung von Antisemitismus im gebildeten Milieu und in Universitäten sowie die Beschreibung gegenwärtiger Vorfälle, weisen dabei auf eine klare, wenn auch traurige, Kontinuität hin: Antisemitismus lässt sich in der deutschen Universitätslandschaft über Jahrhunderte stets nachzeichnen. Die besonders hohe Anzahl antisemitischer Vorfälle an zahlreichen deutschen Hochschulen nach dem 07. Oktober 2023 verdeutlichen dies umso mehr. Dass Universitäten als „Vorreiter judenfeindlicher Diskriminierung“ (Schwarz-Friesel 2016) zu kennzeichnen sind, ist auch für die heutige Zeit zutreffend, wenn antisemitische Inhalte in Seminaren vermittelt werden oder jüdische Studierende daran gehindert werden, Hörsäle zu betreten. Mit Blick auf die jahrtausendealte Geschichte von Antisemitismus im gebildeten Milieu ist diese Feststellung dabei keineswegs überraschend. Als Bildungsinstitutionen sind Universitäten essenzielle Bestandteile unserer Gesellschaft, in denen sich entsprechend auch Antisemitismus als „kultureller Code“ (Volkov 2000) und gesamtgesellschaftliches Phänomen widerspiegelt.
Umso erstaunlicher ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass gegenwärtiger Antisemitismus an Universitäten ein eher vernachlässigtes Forschungsthema zu sein scheint und hier ein ‚blinder Fleck‘ in der Forschung besteht. Zwar lassen sich einzelne Vorfälle und Debatten nachzeichnen, tiefergehende, wissenschaftliche Analysen finden sich allerdings kaum. Dies könnte zu einem Teil an der unzureichenden Quellenlage bzw. schwierigen Datenerhebung (Stichwort: Soziale Erwünschtheit) liegen. Zu einem anderen Teil könnte es auch durch fehlenden Willen, mangelnden öffentlich-gesellschaftlichen Druck oder strukturelle Gründen erklärt werden. Ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass Wissenschaftler:innen einen hohen Preis zahlen könnten, wenn sie die eigene Institution hinsichtlich eines brisanten, unbequemen Themas analysieren und ggf. mit Konsequenzen rechnen müssen. Die aktuellen Geschehnisse an deutschen Hochschulen und die hier vorliegende Analyse, verdeutlichen jedoch einen klaren Forschungs- und Handlungsbedarf für die Zukunft.
ANMERKUNGEN und LITERATUR
1 Eine ausführliche Darstellung würde den Rahmen dieses Beitragssprengen, siehe beispielhaft das Bekenntnis deutscher Professoren zu Adolph Hitler von 1933 oder die umfangreiche Studie Studenten im Dritten Reich von Michael Grüttner (1995).
2 Der Professor Sucharit Bhakdi sagte bspw. in einem Interview: „Das ist das Schlimme an den Juden: Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt – und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt living hell – die lebende Hölle“ (zit. nach Rohwedder 2021). Andere (hoch-)gebildete der Querdenker- und Corona- Leugnerszene, wie etwa der Journalist und Publizist Ken Jebsen, der Unternehmer Michael Ballweg oder der Arzt Bodo Schiffmannbroder sind mit ähnlichen Aussagen aufgefallen (vgl. Leber 2021; Peter 2020).
3 Wann ein Mensch als ‚gebildet‘ bezeichnet werden kann, ist eine subjektive Frage, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich beantwortet werden kann. Ein gesellschaftlich weitgehend anerkannter Gradmesser für den Bildungsgrad ist der Nachweis von Schul- oder Universitätsabschlüssen sowie das Bekleiden höherer gesellschaftlicher Positionen einhergehend mit Ansehen und Renommee.
4 In ersten Studien wurden mittlerweile Verfahren und Ansätze entwickelt, mit denen der Effekt der sozialen Erwünschtheit minimiert bzw. umgangen werden kann, bspw. indem mit doppelten Standards gearbeitet wird (vgl. Cheng/Greene/Kingsbury 2022).
5 Zur Dekanin und ihrem fragwürdigen Umgang mit der Geschichte der Sozialen Arbeit zur Zeit des Nationalsozialismus siehe auch Alting/Momper 2023: 84.
Literaturliste
(pdf)
Der Autor
*****
Dr. Johannes Sosada arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem. Als Reserveoffizier unterrichtet er regelmäßig an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Sein Master- und Bachelorstudium der Politikwissenschaften und Geschichte absolvierte er in Tübingen und Göttingen. Für ein Auslandssemester studierte er an der Ben-Gurion-Universität, Israel, und für ein Auslandsjahr an der Universität Yale, USA.
Kontakt zu COMPASS:
redaktion@compass-infodienst.de
Probe-Abonnement
![]()
Infodienst
! 5 Augaben kostenfrei und unverbindlich !
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo: