ONLINE-EXTRA Nr. 369
Vor wenigen Tagen gedachte man des zweiten Jahrestages des Massakers der Hamas vom 7. Oktober 2023 in Israel. Bei den öffentlichen Kundgebungen, die anlässlich dieses Jahrestages beispielsweise in Berlin, Frankfurt oder München stattfanden, war die Zahl derer, die an pro-palästinensichen Demonstrationen teilnahmen und ein Ende des Krieges im Gazastreifen forderten um ein Vielfaches höher als die Zahl derer, die in trauerndem Gedenken an die Opfer jenes "schwarzen Schabbats" und mit Warnungen vor dem grassierenden Antisemitismus zusammenkamen. Sprach man Teilnehmer der pro-palästinensichen Demonstrationen darauf an, dass sie mit ihrer Teilnahme möglicherweise auch einer antisemitischen Agenda folgten, wurde dies entschieden zurückgewiesen, eine Kritik an Israel oder gar explizit eine antizionistische Haltung sei keineswegs mit Antisemitismus und Judenhass gleichzusetzen sei. Man sei Kritiker Israels, aber ein Freund der Juden. © 2025 Copyright bei der Autorin
Diese Episode mag exemplarisch für eine der umstrittensten Fragen stehen, die in den heftigen Debatten seit dem 7. Oktober 2023 in Anbetracht des explodierenden Judenhasses weltweit diskutiert werden. In den Worten der heutigen ONLINE-Extra-Autorin Eva Illouz: "Ist der Antizionismus eine verschleierte, indirekte Form des Antisemitismus?".
Dieser Frage widmete sich die französisch-israelische Soziologin und Professorin für Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität Jerusalem, die sich auch in Deutschland einen anerkannten Namen gemacht hat, kürzlich in einem bemerkenswerten Essay für das britische Journal "Fathom", das vom "Britain Israel Communications and Research Centre" herausgegeben wird. Nachfolgend ist dieser Essay in einer deutschen Übersetzung von Christoph Münz als ONLINE-EXTRA Nr. 369 unter dem programmatischen Titel zu lesen: "Es ist an der Zeit, die Heuchelei des Antizionismus zu entlarven".
(und für die Übersetzung beim Übersetzer)
online exklusiv für ONLINE-EXTRA
Online-Extra Nr. 369
Bleiben die grundlegenden Prämissen einer Kontroverse unausgesprochen, versperren sie den Weg zu klarem Denken und trüben das Urteilsvermögen beider Seiten. Deshalb möchte ich zu Beginn offenlegen, welche Grundannahmen meiner Überlegung zugrunde liegen – angesichts einer Frage, die seit dem 7. Oktober (und lange davor) im Zentrum zahlreicher Debatten steht: Ist Antizionismus eine Form des Antisemitismus?
Vorläufige Prämissen
Meine erste Prämisse ist, dass ethnische oder rassistische Feindbilder auf binären Unterscheidungen und Hierarchien beruhen – Christen und Juden, Zivilisation und Barbarei, Weiße und Schwarze. Diese Dichotomien sind tief in Sprache, Narrativen und Bildern verankert und verschwinden keineswegs in Gesellschaften, die sich als egalitär verstehen – im Gegenteil: Gerade dort gedeihen sie besonders gut. So hat etwa der Antisemitismus in jüngster Zeit eine erschreckende Rückkehr erlebt, insbesondere seit dem 7. Oktober. Daher können rassistische, sexistische oder antisemitische Stereotype durchaus Verwendung finden, ohne dass man sich ihrer abwertenden Wirkung voll bewusst ist.
Meine zweite Prämisse lautet: So sehr wir uns auch gegen die Verabsolutierung und den Hass zur Wehr setzen mögen, die solchen Kategorien innewohnen – so einfach sterben sie nicht aus. Vielmehr bleiben sie bestehen, verändern ihre Form, schleichen sich durch Hintertüren wieder ein. Als die Jim-Crow-Gesetze aufgehoben wurden, wurde „der Schwarze“ mit Kriminalität assoziiert; als der Feminismus zu gesetzlichen Veränderungen führte, tauchte das Zerrbild der „dämonisch ehrgeizigen Frau“ auf. Hierarchische Binärlogiken haben ein langes Leben, weil sie auf kognitiven und affektiven Mustern beruhen, die sich immer wieder neu inkarnieren. Der Antizionismus könnte ein Beispiel für eine solche neue Form sein.
Meine dritte Prämisse ist, dass diese Hierarchien so tief in unsere Wahrnehmungsmuster eingeschrieben sind, dass es weit mehr braucht als sich ihrer lediglich bewußt zu werden, um sich ihrer zu entledigen. Das kulturelle Unbewusste macht vor niemandem Halt – auch nicht vor den Angehörigen diskriminierter Gruppen. So können Frauen sexistisch, Juden antisemitisch und Antikolonialisten rassistisch agieren. Daraus folgt: Das Argument „Ich kann kein Sexist/Rassist/Antisemit sein, weil ich selbst Frau/Schwarzer/Jude bin“ ist unhaltbar. Niemand ist qua Identität von Vorurteilen befreit. Dass viele Antizionisten Juden sind, beweist in keiner Weise, dass antizionistische Ideologien frei von antisemitischen Inhalten wären.
Ich lege diese Prämissen offen, um eine der komplexesten und kontroversesten Fragen der politischen Gegenwart angemessen zu verhandeln: Ist der Antizionismus eine verschleierte, indirekte Form des Antisemitismus?
Minderheiten Glauben schenken
Die sich selbst als progressiv verstehende Linke – darunter Stimmen wie Judith Butler, Pankaj Mishra oder Masha Gessen (deren jüngster Essay Drawing the Line on Antisemitism in der New York Times eine Welle von Reaktionen auslöste) – hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um zwischen Antizionismus als politischer Ideologie und Antisemitismus als abscheulichem, irrationalem Ressentiment zu unterscheiden.
Diese Unterscheidung beruht auf zwei, auf den ersten Blick plausiblen Gründen: Erstens muss es möglich sein, Israels Politik zu kritisieren, wann immer sie dies verdient, ohne deshalb sogleich unter den Verdacht des Antisemitismus zu geraten. Zweitens haben Vertreter des israelischen Establishments – allen voran Netanyahu – den Vorwurf des Antisemitismus bisweilen zynisch instrumentalisiert, um Kritik an Völkerrechtsverstößen, Kriegsverbrechen oder der anhaltenden, moralisch fragwürdigen Besatzung zum Schweigen zu bringen.
Doch ich glaube, bei der hartnäckigen Trennung von Antizionismus und Antisemitismus steht noch mehr auf dem Spiel.
Seit dem 7. Oktober sind viele liberal gesinnte, zionistische Juden zunehmend irritiert über die Art und Weise, wie der Antizionismus verwendet wird. Warum ist ausgerechnet die jüdische Emanzipationsbewegung die einzige, deren Legitimität 120 Jahre nach ihrer Entstehung noch immer grundsätzlich infrage gestellt und verleumdet wird? Warum ist Israel der einzige Staat weltweit, dessen Existenz als diskussionswürdig gilt – bis hin zum Small Talk am Abendbrottisch? Weshalb ist die kategorische Ablehnung des Zionismus zu einem so zentralen Bestandteil progressiver Identität geworden? In einer Welt voller Verfolgung, Kriege, Massaker, Völkermorde und Bürgerkriege wirkt die obsessive Fixierung auf die Verfehlungen Israels verdächtig – so, als sei mehr im Spiel als nur eine tatsächliche Schuld Israels. Um diesem Verdacht nachzugehen, braucht es ein methodisches Vorgehen, das zwei Fragen adressiert: Diskriminiert der Antizionismus Juden (also behandelt er sie anders als andere Gruppen) und: entmenschlicht er sie?
Bei der Beurteilung, ob eine Äußerung, ein Verhalten oder eine Idee diskriminierend, sexistisch, rassistisch oder islamfeindlich ist, hat sich die progressive Linke im Allgemeinen einem klaren Prinzip verpflichtet: Man hört auf die Stimmen der betroffenen Minderheiten. Diese Haltung gilt als einzig logisch, denn wenn eine bestimmte Praxis einer Gruppe nützt und einer anderen schadet, dann darf nicht die privilegierte Gruppe allein darüber befinden, ob diese Praxis verletzend ist. Ob etwa eine Bemerkung zur Kleidung einer Frau ein bloßes Kompliment oder sexualisierte Belästigung am Arbeitsplatz darstellt, kann nur die betroffene Frau – nicht der Mann – entscheiden. Dieses Prinzip hat breite Akzeptanz gefunden – mit einer auffälligen Ausnahme: den Juden.
Zahlreiche Juden weisen mit Nachdruck darauf hin, dass Tonfall und Rhetorik des Antizionismus oftmals antisemitisch aufgeladen sind. Und doch werden diese Hinweise von derselben Linken, die in allen anderen Fällen die Definitionsmacht betroffener Minderheiten anerkennt, beharrlich ignoriert oder abgetan. In vielen westlichen Demokratien haben Muslime beispielsweise erfolgreich geltend gemacht, dass Diskussionen über den Einfluss der Muslimbruderschaft in westlichen Gesellschaften oder die patriarchalische Unterdrückung von Frauen durch den Schleier islamfeindlich und westlich-zentriert seien. Wir können daher mit Fug und Recht fragen, warum das Gleiche nicht für Juden gilt. Warum bleibt die Linke taub gegenüber den Einwänden der Juden, dass Antizionismus, wenn schon nicht gleichbedeutend mit Antisemitismus, ihm doch beunruhigend nahe kommt?
Darüber hinaus sind Juden meines Wissens nach die einzige Minderheit, die offen und systematisch verdächtigt wird, ihre Opferrolle („die Shoah“ oder „Antisemitismus“) zu manipulieren, um politische und symbolische Ziele zu erreichen. Ich habe noch nie gehört, dass andere ethnische oder rassische Gruppen derselben Anschuldigung ausgesetzt wären, zumindest nicht im liberalen Lager. Wir alle würden erschaudern bei der Behauptung, dass Nachkommen von Sklaven ihre Geschichte und ihre Opferrolle ausnutzen, um politische Privilegien zu erlangen. Doch genau das behaupten Progressive regelmäßig über Juden und Antisemitismus und verspotten und verhöhnen dabei oft die Ängste und die Trauer der Juden.
Warum also diese krasse Asymmetrie zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Minderheiten, wenn es darum geht, das eigene historisches Gedächtnis heranzuziehen und selbst zu bestimmen, was die eigene Würde verletzt? Ich gehe nicht davon aus, dass diese Diskrepanz aus einem bewussten Hass auf Juden resultiert. Viel wahrscheinlicher ist: Auch wenn Muslime – um bei diesem Beispiel zu bleiben – in ihrer Gesamtheit demografisch, territorial und (in ihrer Gesamtheit) wirtschaftlich deutlich größer sind als die jüdische Gemeinschaft, gelten sie im westlichen Diskurs als schutzbedürftige Minderheit. Juden hingegen – insbesondere in Verbindung mit dem Staat Israel – wird dieser Minderheitenstatus abgesprochen. Wenn etwa zwei Milliarden Menschen auf dieser Welt Muslime sind, mithin nahezu 30 Prozent der Weltbevölkerung, und Juden kaum 15 Millionen Menschen, oder gerade mal 0,2 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, qualifizieren sich letztere glasklar weitaus mehr für den Status einer vulnerablen Minderheit. Dennoch gelten sie in den Demokratien des Westens häufig nicht als vulnerable Minderheit, sondern als Teil einer dominanten, „weißen“ Elite – ein Eindruck, der durch ihre Assoziation mit Israel als militärisch erfolgreichem Staat weiter verstärkt wird. Umfragen in Europa und den USA zeigen immer wieder, dass ein Drittel oder mehr der Bevölkerung glaubt, Juden hätten „zu viel Macht“.1 Noch aufschlussreicher, junge Menschen, die sehr wahrscheinlich deutlich progressiver sind als ältere Menschen, neigen noch stärker dem Glauben zu, Juden würden zu viel Macht über die Medien und die Wirtschaft besitzen.
EVA ILLOUZ
Am 7. Oktober 2023 verübte die radikalislamische Terrormiliz Hamas verheerende Anschläge in Israel. Doch am nächsten Tag dominierte nicht Mitgefühl für die Angegriffenen die öffentliche Meinung. Vielmehr wurden die Attacken in progressiven Kreisen von Berlin über Paris bis New York als Akt des Widerstands legitimiert, ja teilweise sogar bejubelt. Woher kommt dieser Hass, der sich selbst für moralisch überlegen hält?
Die Ereignisse vom 7., aber auch die vom 8. Oktober haben Eva Illouz tief erschüttert. In ihrer kämpferischen Intervention zeichnet sie nach, wie Identitätspolitik und vom französischen Poststrukturalismus inspirierte Theorien zum Nährboden für ein Denken werden konnten, das historische Tatsachen und die ihnen innewohnende Komplexität ausblendet und Israel zum Inbegriff des kolonialistischen Bösen stilisiert.
Die doppelte Asymmetrie Man beachte, dass die oberflächliche Unterscheidung zwischen Antizionismus und Antisemitismus hier wiederholt wird, um Vorwürfen des Antisemitismus zuvorzukommen und die Juden zum Schweigen zu bringen, die sich durch die Tatsache erniedrigt oder beleidigt fühlen könnten, dass in der langen Liste der Leiden, die der Welt Verdammnis und Verderben bringen, nur Israel und der Zionismus erwähnenswert sind. Nicht der Klimawandel, nicht der Atomkrieg, nicht die brutale Unterdrückung der Frauen in Afghanistan, nicht der russische Krieg gegen die Ukraine, nicht der Hunger in der Welt und vermeidbare tödliche Krankheiten, nicht die Millionen von Vertriebenen und Ermordeten in der Republik Kongo. Nur Israel und der Zionismus. Das sollte uns fassungslos machen.
Diese Asymmetrie im Umgang der politischen Linken mit Muslimen einerseits und Juden andererseits offenbart eine doppelte Form der Diskriminierung: Zum einen wird der Islam – trotz seiner globalen Reichweite und religiösen Macht – als schutzbedürftig angesehen. Dies offenbart eine orientalistische Herablassung (Den Islam zu beschützen unterscheidet sich wesentlich vom Schutz muslimischer Minderheiten in westlichen Gesellschaften vor konkreter und aktueller Diskriminierung). Und es diffamiert den Minderheitenstatus der Juden, weil diese implizit mit Macht und Herrschaft identifiziert werden.
Mehr noch: Wenn Juden gezwungen sind, die Existenz Israels zu rechtfertigen, berufen sie sich zumeist auf das Fortwirken des Antisemitismus – ein Argument, das jedoch im moralischen Vokabular der progressiven Linken sofort seine Gültigkeit verliert. Es wird entwertet, umcodiert – als „Instrumentalisierung“ einer tragischen Geschichte, die zur „Waffe“ wird, um Israels Verbrechen reinzuwaschen. Die Angst vor oder Anprangerung von Antisemitismus durch Juden wird tautologisch in einen „Beweis“ oder ein Zeichen für listige Manipulation umgewandelt und damit automatisch disqualifiziert. Es sei darauf hingewiesen, dass die listigen Manöver des Iran und anderer muslimischer Länder, jede Kritik am politischen Islam als islamfeindlich abzutun und zu disqualifizieren, bei der progressiven Linken nie auf ein ähnliches a priori-Misstrauen gestoßen sind.
Zeitgenössischer Antizionismus
So können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass zwei zentrale Tropen des traditionellen Antisemitismus nahezu dieselben sind wie die, die den Zionisten und dem Zionismus zugeschrieben werden: tentakelartige zerstörerische Kraft und böswillige Intrigen, um sich der Verantwortung zu entziehen.
Lassen sie mich ein Dokument zitieren, das 2025 vom Dyke March2 in New York veröffentlicht wurde. Das Dokument enthält eine lange Aufzählung lohnenswerter Anliegen, für die sich Dykes einsetzen:
Für körperliche Autonomie und reproduktive Gerechtigkeit; Für die Befreiung aller unterdrückten Menschen; Pro Einwanderer; Körperneutral und fettpositiv; Inklusiv gegenüber allen Religionen und spirituellen Praktiken; Unterstützend gegenüber Sexarbeitern; Sex- und Kink-positiv; Generationsübergreifend; Für Selbstfindung; Nicht-hierarchisch; Ein Ort für Gemeinschaft und queere Freude; Inklusiv.
In dieser langen Liste an unterstützenswerten Anliegen steht nur eine einzige auf der Abschussliste des Bösen: der Zionismus. Urteilen sie selbst: „Antizionistisch: Wir lehnen die nationalistische politische Ideologie des Zionismus ab, insbesondere, wie sie innerhalb amerikanischer Institutionen propagiert wird, um das palästinensische Volk zu unterwerfen, zu vertreiben und zu marginalisieren. Antizionismus weist die imperialistische Vorstellung zurück, dass das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes dazu dienen könne, institutionelle Ungleichheit, erzwungene Vertreibung oder gar ethnische Säuberung und Genozid an einer anderen ethnischen Gruppe zu rechtfertigen. Wir unterscheiden klar zwischen der Kritik an Zionismus als politischer Ideologie und Antisemitismus. Wir stellen uns gegen Antisemitismus in all seinen Formen und erkennen an, dass das jüdische Volk historisch und bis heute Unterdrückung ausgesetzt war. Unsere Kritik richtet sich gegen ein politisches System, nicht gegen Jüdinnen und Juden oder das Judentum.“
Noch interessanter in diesem Dokument ist die Vermischung und Gleichsetzung von Zionismus und israelischer Politik. Tatsächlich ist es nicht der Zionismus, der die israelische Politik gutheißt, sondern der Antizionismus, der Israel und seine Politik miteinander vermischt und den Zionismus in eine bösartige historische Logik, ein böses Wesen, verwandelt. Meines Wissens nach wurde noch keine andere nationale Bewegung, die ein Volk vertritt, zu einem generativen Prinzip des Bösen stilisiert. Beispielsweise führten die Teilung Indiens sowie die Gründung mehrerer Staaten in Osteuropa dazu, dass Millionen Menschen gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen – solche Nationalismen wurden jedoch nicht als dämonische Ideologien bezeichnet, noch wurden die daraus entstandenen Staaten zu dämonischen Gebilden erklärt. Kommunistische Nationen wie Kambodscha oder China, die für eine unvorstellbare Zahl barbarischer Todesfälle verantwortlich sind, wurden von der liberalen Linken nicht essentialisiert und dämonisiert, wie es dem Zionismus und Israel in Slogans wie „Zionismus ist Rassismus“ widerfuhr oder sich in der Anschuldigung des „Völkermords“ niederschlug, die bereits drei Tage nach dem 7. Oktober die Runde machte (siehe beispielsweise Riyad Mansour, palästinensischer UN-Gesandter).
Der britische Punk-Sänger Bob Vylan brachte in seinem Bühnengesang prägnant auf den Punkt, wie Israelis gesehen werden: „Death, death to the IDF“ („Tod, Tod dem israelischen Militär“). Israel ist die einzige Nation, deren Bürger boykottiert werden (die Tradition ist alt: „Ghettos“ waren frühe Formen des Boykotts) und deren Tod öffentlich gefordert und von einem begeisterten Publikum beklatscht wird. Das liegt daran, dass der Zionismus ein Zeichen der Schande darstellt und der Antizionismus, wie der marxistische Wissenschaftler Steve Cohen es ausdrückt, transzendental geworden ist, eine prinzipielle Opposition gegen Israel, unabhängig von dessen Politik und Handlungen.
Angesichts der Tatsache, dass der Zionismus den Juden ihr Selbstbewusstsein zurückgegeben und ihnen ermöglicht hat, mit erhobenem Kopf durch die Welt zu gehen, ist die Kriminalisierung des Zionismus für Juden in etwa dasselbe wie eine Kriminalisierung des Selbstbewußtseins der Homosexuellen oder der Würde der Schwarzen. Dies ist vielleicht der Grund, warum Progressive eine Unterscheidung zwischen Zionisten und Juden, zwischen Antizionismus und Antisemitismus fordern. Da sie sich bewusst sind, dass Antizionismus eine Quelle jüdischen Selbstbewußtseins verunglimpft, versuchen sie, das Offensichtliche zu umgehen und zu verschleiern: Zionismus vom Judentum zu trennen ist wie Weizen ohne Spreu essen zu wollen. Zionismus und Judentum sind so eng miteinander verbunden, dass nur eine ordentliche Portion Böswilligkeit und Selbsttäuschung etwas anderes vortäuschen können.
Dennoch hat die progressive Linke immense Energie aufgewendet, um uns davon zu überzeugen, dass die antizionistischen Bundisten von einst, die glaubten, die Juden würden den Antisemitismus durch kulturelle Autonomie in Europa überwinden, dieselben sind wie diejenigen, die Todeslieder auf Israel singen (viele der Bundisten wurden von Hitler oder Stalin ermordet, was ihrer integrativen Philosophie sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne einen entscheidenden Schlag versetzte). Der Versuch, einerseits eine Trennlinie zwischen Antizionismus und Antisemitismus zu ziehen und andererseits zeitgenössische Antizionisten, die die Zerschlagung Israels fordern, als harmlose Bundisten zu betrachten, hat zu einer enormen (und absichtlichen) Verwirrung mit vier konkreten Auswirkungen geführt.
Erstens erschwert es Juden, Grenzen zu definieren und überhaupt die Realität von Straftaten gegen sie festzulegen – ein Recht, das anderen Minderheiten selbstverständlich zusteht. Juden können die Bedingungen für ihre Würde nicht mehr festlegen.
Zweitens macht die Unterscheidung zwischen Antizionismus und Antisemitismus Juden nur dann akzeptabel, wenn sie dem Zionismus abschwören, ähnlich wie Christen von Juden verlangt hatten, ihrem Glauben und ihrer Selbstdefinition abzuschwören, um verschont zu bleiben.
Drittens erzeugt die progressive Linke durch ihre Unterstellung, dass jede Anprangerung von Antisemitismus ein Manöver im Interesse Israels sei, einen hermetischen Zirkelschluss: Sie schafft die tautologischen Voraussetzungen, um sich a priori von jeglichem Vorwurf ethnischen, rassistischen und religiösen Hasses gegen Juden freizusprechen, und reproduziert gleichzeitig das antisemitische Klischee von Juden als intriganten, manipulativen und destruktiven Akteuren.
Schließlich erweitert die Unterscheidung zwischen Antizionismus und Antisemitismus den begrifflichen Spielraum für Antisemitismus: Der Keil, den sie anscheinend zwischen einer politischen Meinung und unrechtmäßigem Hass treibt, verschleiert die Kontinuität zwischen beiden und haucht dem Antisemitismus neues Leben ein. Genau das ist es, was Gessens Artikel erreicht hat: einen neuen begrifflichen Spielraum für Antisemitismus zu schaffen. Laut Gessen waren die Erschießung von zwei Mitarbeitern der israelischen Botschaft vor dem Capital Jewish Museum am 21. Mai und der Brandanschlag auf eine pro-israelische Kundgebung in Boulder nicht antisemitisch, sondern „untrennbar” mit Gaza verbunden, d. h. nicht durch Hass, sondern durch politische Meinung motiviert. In Gessens These geht es um die Umwandlung von ethnischem Hass in eine respektable politische Meinung.
Probe-Abonnement
![]()
Infodienst
! 5 Augaben kostenfrei und unverbindlich !
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo:
Schlussfolgerung
Wir müssen ein für alle Mal mit dem doppelten Irrglauben aufräumen, dass Zionismus gleichbedeutend mit der Unterstützung israelischer Regierungspolitik ist und dass Antizionismus und Antisemitismus sich grundlegend unterscheiden – der eine legitim, der andere abscheulich. Tatsächlich sind sie zwar nicht gleichbedeutend, weisen aber durchaus eine „familiäre Ähnlichkeit“ auf. Der Antisemitismus liefert dem Antizionismus einige der Schlüsselbegriffe seines Vokabulars und die Grundprinzipien seiner moralischen Grammatik. Antisemitismus ist die Schiene, auf welcher der Schnellzug des Antizionismus bequem fahren kann. Der Großteil des heutigen organisierten Antizionismus basiert nicht auf einer politischen Idee. Er ist nicht einmal eine Ideologie. Er ist eine Form des Hasses.
Eine große Anzahl von Juden, mich eingeschlossen, hat keinerlei Schwierigkeiten damit, Zionist zu sein und die Unmenschlichkeit des Krieges, der in Gaza geführt wird, sowie die Unmoral der Besatzung auf das Schärfste zu verurteilen.3 Wir haben keine Schwierigkeiten damit, Netanjahus Zynismus und das Toxische seiner Politik zu erkennen, und dennoch stellen wir niemals die Existenz Israels in Frage. Netanjahu macht die Existenz Israels nicht ungültig, genauso wenig wie Putin diejenige Russlands. Juden „instrumentalisieren” Antisemitismus nicht mehr und nicht weniger, um ihre Ziele zu erreichen, als Muslime Islamophobie „instrumentalisieren”, um Punkte zu sammeln und strategische Vorteile im politischen Bereich zu erlangen. Eine solche Instrumentalisierung in eine Leugnung des Antisemitismus und einen Aufruf zur Vernichtung Israels umzuwandeln, ist jedoch sowohl Vorurteil als auch Hass.
Es gibt keinen logischen Zusammenhang zwischen der Verurteilung der unmoralischen Handlungen Israels oder des Zynismus Netanjahus einerseits und Antizionismus andererseits. Ein Zionist zu sein bedeutet in keinerlei Weise über die Frage nachzudenken, ob Israel, ein sehr fehlerhafter und unvollkommener Staat wie die meisten Staaten, legitim ist, genauso wie man sich nicht über die Legitimität von Portugal, Pakistan oder Brasilien Gedanken macht (und Progressive die Existenz von wiederholten Verstößen Russlands oder Chinas gegen internationale Normen nicht in Frage stellen). Für den Antizionismus ist dies jedoch eine berechtigte Frage: Der einzige Staat der Juden ist der einzige unter allen Staaten, der „zerschlagen“ werden sollte – physisch oder symbolisch – und der einzige Staat, dessen Bürger von der Mitgestaltung menschlicher Angelegenheiten ausgeschlossen, d. h. boykottiert werden sollten. Der Antizionismus macht den Hass auf Israelis zu einem Zeichen der Tugend.
Die Behauptung, Antizionismus sei völlig unabhängig von Antisemitismus, ist kognitiv nicht plausibel und moralisch unredlich. Stellen Sie sich einmal eine ganze intellektuelle Bewegung vor, die die Zerschlagung afrikanischer Nationen unterstützt, sie meidet und zu Paria erklärt, sie unter dem Vorwand ihrer endlosen Kriege obsessiv diffamiert und gleichzeitig hoch und heilig schwört, dass eine solche Haltung nicht rassistisch sei... Es ist zweifelhaft, dass sich viele davon täuschen lassen würden. Doch genau das hat der Antizionismus getan. Er war dabei erfolgreich, weil Zionisten Juden sind und weil es eine lange Tradition gibt, Juden auszugrenzen und zu dämonisieren. Er verweigert den Juden eine zentrale und wesentliche Dimension ihrer Existenz und Selbstdefinition; er verlangt von den Juden, dass sie einen grundlegenden Teil ihrer selbst und ihrer Identität verleugnen. Mehr noch: Wie die Reaktionen auf den 7. Oktober gezeigt haben und wie Gessens Artikel schmerzlich deutlich macht, geht es beim Antizionismus möglicherweise darum, die Tötung von Juden, wenn schon nicht zu legitimieren, so doch zumindest als weniger verwerflich zu qualifizieren.
Es besteht eine semantische Kontinuität zwischen der Art und Weise, wie Juden in einer christlichen Welt diffamiert wurden, die sie mit Gottesmord, dem Vergießen von nicht-jüdischem Blut – insbesondere von Kindern – und rituellen Morden in Verbindung brachte, und der Sichtweise, dass Israel einzigartig destruktiv und kriminell sei. Eine säkulare Ideologie, deren Ziel es war, den Juden ihre Würde und Unabhängigkeit zurückzugeben, wurde als Inkarnation des Bösen, die nichts anderem gleicht, ausgesondert. Keine Parole kann verdecken, was offensichtlich ist: Antisemitismus gibt dem Antizionismus seinen Treibstoff und seine Leidenschaft, seine Semantik und seine Archetypen. Wenn die „Woke“-Ideologie einen moralischen Fortschritt markiert hat, dann gerade dadurch, dass sie uns bewusst gemacht hat, dass Frauenfeindlichkeit, Homophobie und Rassismus tief verwurzelte Strukturen haben. Wenn dies für diese Phänomene gilt, dann gilt es umso mehr für den Antisemitismus.
Es ist an der Zeit, diese Täuschung zu entlarven, denn der transzendentale Antizionismus ist für viele oder sogar die meisten Juden zutiefst verletzend und dient der palästinensischen Sache in keiner Weise. Er hindert uns daran, die dringenden Aufgaben zu bewältigen, die vor uns liegen: Israels rücksichtslose Zerstörung des Gazastreifens zu stoppen, den Gazastreifen wieder aufzubauen, den Palästinensern eine humane Zukunft zu geben, dauerhaften Frieden in der Region zu schaffen und eine zukünftige Führung im Gazastreifen ohne genozidale Bestrebungen gegen Israel sicherzustellen. Solange unsere Sprache von Antisemitismus kontaminiert ist und solange der Antizionismus weiterhin Kritik an Israel mit seiner Dämonisierung vermischt, werden wir uns nur weiter weg von diesen Zielen entfernen.
ANMERKUNGEN
1 https://d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net/documents/econTabReport_tT4jyzG.pdf siehe Seite 105; https://www.adl.org/resources/report/antisemitic-attitudes-america-topline-findings; https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/. Die Ergebnisse der Umfrage kann man hier nachlesen: https://www.adl.org/adl-global-100-index-antisemitism. Leser können zu den gewünschten Statistiken auf Länderebene navigieren.
2 Ein Dyke March ist eine Demonstration für lesbische Sichtbarkeit und politische Forderungen, die ursprünglich in den USA entstand und mittlerweile auch in vielen deutschen Städten stattfindet. Der Begriff „Dyke“, ursprünglich ein Schimpfwort, wird dabei von der lesbischen Gemeinschaft selbstbewusst als positive Selbstbezeichnung „reklamiert“. (Anm. des Übersetzers)
3 Siehe beispielsweise: Eva Illouz: “If Zionism is hijacked by an authoritarian and anti-democratic political project, what will be left of it?”, K, 10. April 2025.
Die Autorin
 Eva Illouz ist eine französisch-israelische Soziologin und Autorin. Sie ist Professorin für Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität Jerusalem. Ihre Werke wurden in mehr als 10 Sprachen übersetzt, darunter auch ins Deutsche (zuletzt: "Der 8. Oktober: Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus", Suhrkamp Verlag, Berlin 2025).
Eva Illouz ist eine französisch-israelische Soziologin und Autorin. Sie ist Professorin für Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität Jerusalem. Ihre Werke wurden in mehr als 10 Sprachen übersetzt, darunter auch ins Deutsche (zuletzt: "Der 8. Oktober: Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus", Suhrkamp Verlag, Berlin 2025).
Der obige Artikel erschien im Juli 2025 in der englischsprachigen Zeitschrift "Fathom". Wir veröffentlichen ihn hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin. Aus dem Englischen übersetzt von Christoph Münz.

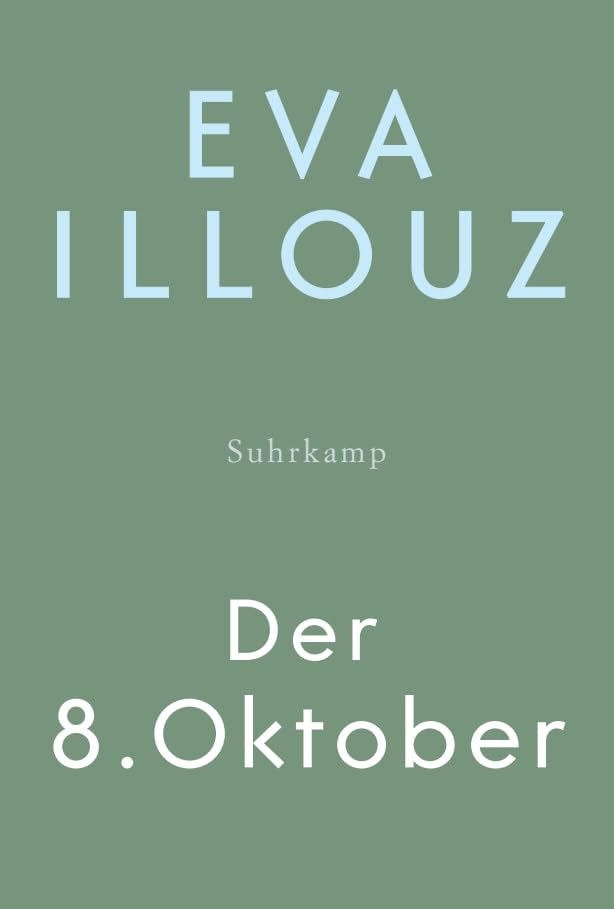 Der 8. Oktober
Der 8. Oktober