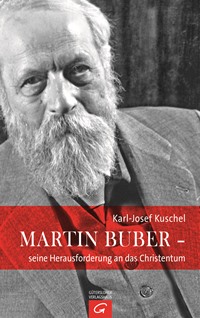ONLINE-EXTRA Nr. 225
© 2015 Copyright bei Autor und Verlag
"Philosoph des Dialogs", "Anti-Dogmatiker und Religionskritiker", "Stimme des deutschen Judentums" - so lautet eine kleine Auswahl an programmatischen Überschriften einiger Artikel, die vor kurzem anlässlich des 50. Todestages von Martin Buber erschienen sind. Wie kaum ein anderer jüdischer Denker des 20. Jahrhunderts hat Martin Buber den menschlichen und theologischen Neuanfang des christlich-jüdischen Miteinanders im Schatten des Holocaust inspiriert, gefördert und geprägt. Seine Philosophie des Gesprächs, sein tiefer Respekt vor dem "Du", dem "Anderen", sein "antitotalitäres Denken" (Joachim Gauck) und seine heute vielleicht mehr denn je aktuellen Gedanken zum jüdisch-arabischen Verhältnis, die ihn als "utopischen Realist" (Micha Brumlik) ausweisen, deuten an, wie sehr eine ernsthafte Lektüre Bubers lohnenswerter denn je sein könnte.
Wie sehr all dies nicht zuletzt und insbesondere im Blick auf den herausfordernden Charakter von Bubers Denken für das Christentum gilt, dafür legte nun kürzlich der Theologe Karl-Josef Kuschel mit seiner im Gütersloher Verlagshaus erschienenen Publikation "Martin Buber - seine Herausforderung an das Christentum" einen beeindruckenden Beleg vor. Gleich zu Beginn seines unbedingt lesenswerten Buches skizziert Kuschel die leitmotivischen Fragen seines Zugangs zu Buber in eigenen Worte wie folgt:
"Worum es in diesem Buch geht? Was hat ein jüdischer Denker Christen über ihren Glauben an den Juden Jesus von Nazareth zu sagen? Und: Wo sieht er Möglichkeiten und Grenzen des Dialogs von Juden und Christen? Welche Maßstäbe hat er gesetzt? Er, Martin Buber, ein jüdischer Denker von Format. Im 20. Jahrhundert hat er seinesgleichen nicht."
COMPASS freut sich, seinen Leserinnen und Lesern nachfolgend die programmatische Einleitung aus Kuschels Buch im Wortlaut präsentieren zu können - und dankt Autor und Verlag herzlichst für die Genehmigung dazu!
online exklusiv für ONLINE-EXTRA
Online-Extra Nr. 225
PROLOG: Gute Gründe, sich an Martin Buber zu erinnern
Der erste Bundespräsident Deutschlands nach dem Krieg, THEODOR HEUSS (1884 - 1963), nennt ihn einen „bewussten Juden und einen Mehrer jüdischen Geistesgutes in religiösen Dingen“, „aus der deutschen Geistesgeschichte der letzten vierzig Jahre einfach nicht hinwegzudenken“ (B III, 447f.). HERMANN HESSE (1877 - 1962) würdigt ihn „als großen Lehrer und Führer der geistigen Elite unter den Juden“, aber auch im Blick auf seine „Erzählungen der Chassidim“ als „großen Schriftsteller“ (B III, 225). Dass ihm persönlich die „Größe und Schönheit“ der jüdischen Welt sichtbar geworden sei, daran habe „die Bekanntschaft“ mit dem Werk dieses Mannes den „größten Anteil“ (SW 12, 505). Der protestantische Theologe HELMUT GOLLWITZER (1908 - 1993) spricht von ihm als dem ersten Menschen nach dem großen jüdischen Aufklärer und Freund GOTTHOLD EPHRAIM LESSINGs, MOSES MENDELSSOHN (1729-1786), der nicht nur als Mensch, sondern als Jude akzeptiert worden sei; selbst den Gebildeten unter den Verächtern der Religion habe er das Judentum aufzuschliessen vermocht (MBW 9, 57). Ja, kein Jude habe auf die deutsche literarische und religiöse Kultur einen solchen Enfluß gehabt wie dieser Mann, meint auch der amerikanische jüdische Gelehrte MICHAEL WYSCHOGROD, 1928 in Berlin geboren, zuletzt bis 2002 Professor an der University of Houston/Texas (MBW 9, 57f.). Und ein anderer unter den großen jüdischen Denkern des 20. Jahrhunderts, ABRAHAM JOSCHUA HESCHEL (1907 - 1972), erkennt im Rückblick auf sein Leben: „Sein größter Beitrag war er selbst, sein Sein. In seiner Persönlichkeit war Magie, Reichtum seiner Seele“ (M. FRIEDMAN, M.B., 1999, 547) Die Rede ist von Martin Buber, am 8. Februar 1878 in Wien geboren, gestorben am 13. Juni 1965 in Jerusalem.
Warum sich aber heute, 50 Jahre nach seinem Tod, an ihn erinnern? Gute Gründe gibt es dafür. Zehn davon habe ich aufgeschrieben. Sie haben mich inspiriert, diese Annäherung zu wagen.
(1) Ein erster Grund: Wem das Gespräch von Juden und Christen mehr ist als ein intellektuelles Gedankenspiel oder mehr als eine historische Materie, wem es eine persönliche Herausforderung ist, will sagen: eine Auseinandersetzung mit einmal getroffenen Glaubensentscheidungen, wer also, sage ich, der Überzeugung ist, alles im Bereich des gewohnten Glaubens gehöre noch einmal in der Perspektive eines Anderen bedacht, gehöre von Alternativen her noch einmal überprüft, dem kann Bubers Werk wie kaum ein anderes im 20. Jahrundert zeigen, was zwischen Juden und Christen auf dem Spiel steht. Und Buber zeigt es mit einer exemplarischen Mischung aus Erzählkunst, Sachlichkeit und Leidenschaft.
Das Gespräch von Juden und Christen ist ein unabgeschlossener Prozess, auch in Deutschland. Gegenwärtig allerdings ist es vielfach gefährdet, ob durch politischen Extremismus oder religiösen Exklusivismus. Deshalb braucht es immer wieder neues Vertrauen. Seine Agenda ist nicht erledigt. Im Gegenteil, sie erfordert stets aufs Neue geistige Anstrengungen. Vielfach gelähmt kommt sie einem heute vor, diese Agenda, verglichen mit den Aufbrüchen der siebziger und achtziger Jahre, die auch mich als Studierenden der Theologie damals „mitgerissen“ haben, als ich in Tübingen erstmals Einblicke in die fatale Geschichte kirchlicher Judenverachtung bekomme und zugleich wieder Begegnung mit Vertretern des deutschsprachigen Judentums möglich werden. Mehr dazu in der kleinen Skizze „In eigener Sache“ am Ende dieses Buches. Etablierte Gremien und Gesprächskreise existieren noch, aber vieles ist zur Gewohnheit geworden. Eine Stagnierung ist unverkennbar, auch ein mangelndes Interesse der Öffentlichkeit, auf Politisches in Nahost fixiert, die Glaubensfragen von Extremismus und Gewaltausbrüchen verdunkelt.
Gewis: Die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben gegenwärtig angesichts des Zustroms aus dem Osten gewaltige Integrationsleistungen zu vollbringen, die viele Kräfte bündeln und absorbieren. Zugleich aber steht das deutsche Judentum äußerlich so gefestigt da wie seit 1945 nicht mehr - mit über 100.000 Mitgliedern in mehr als 110 Gemeinden, mit Synagogenneubauten in vielen deutschen Städten und mit einer Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, mit einem Kolleg für Reform - Judentum in Potsdam (das ABRAHAM - GEIGER - Kolleg) sowie mit einer „School of Jewish Theology“ und einem ZACHARIAS - FRANKEL - Campus für Konservatives Judentum an der Universität in Potsdam. Für judaistische Bildung, Ausbildung und Nachwuchsförderung ist gesorgt. Gute Voraussetzungen, neue Begegnungen zu suchen, neue Dialog- und Kooperationsstrukturen aufzubauen oder gegebene neu zu beleben. Denn auch 50 Jahre nach Bubers Tod ist im Gespräch von Juden und Christen nichts selbstverständlich. Einmal Erreichtes? Wie schnell wird es wieder brüchig. Vertrauen? Wie wenig braucht es oft, dass das gewonnene erodiert und in altes Misstrauen umschlägt. Wir haben es im Frühjahr 2014 erlebt: Wie schnell konnnten Konflikte der Nahostpoltik nach Deutschland überschwappen und hier lebende jüdische Mitbürger/Innen plötzlich mit einer Hasswelle des Antisemitismus überrollen, die man im Deutschland nach der Schoah nicht mehr für möglich gehalten hat. Hier ist kein „Dialog“, hier ist elementare Solidarität gefragt. Sich an Martin Buber erinnern, heisst auch, sich einer fatalen Geschichte fehlender Solidarität mit dem deutschen Judentum zu erinnern, als es darauf ankam.
(2) Aber 50 Jahre nach seinem Tod das Vermächtnis Martin Bubers bedenken, heißt zweitens, von einer Geschichte der Hoffnung erzählen. Buber selber ist einen schwierigen Weg gegangen, den Weg von der Konfrontation zum Dialog, vom Monolog zur Zwiesprache, von der Entfremdung zur Partnerschaft von Juden und Christen vor Gott und den Menschen. Auch Buber hat einen langen Weg gehen müssen, bis er zu Sätzen wie diesen fähig war: „Sobald es uns, Christen und Juden, wirklich um Gott selber und nicht bloß um unsre Gottesbilder zu tun ist, sind wir, Juden und Christen, in der Ahnung verbunden, dass das Haus unsres Vaters anders beschaffen ist, als unsere menschlichen Grundrisse meinen.“ (MBW 9, 137) Und diese Verbundenheit wird vor allem im gemeinsamen Hören auf die Schrift konkret. Um deren „Verdeutschung“ hat sich Buber wie kein Anderer im 20. Jahrhundert verdient gemacht. Anfangs noch zusammen mit dem ihm kongenialen FRANZ ROSENZWEIG (1886-1929), dann bis ins hohe Alter hinein allein, nachdem sein Partner mit nur 43 Jahren einer schrecklichen Krankheit erlegen war. Um Wiederbelebung der „gemeinsamen Urwahrheit“ ging bei diesem kühnen Unternehmen, auf die Juden und Christen gleichermaßen verwiesen sind: auf das Geheimnis „Israel“ als von Gott erwähltem und trotz allem durch die Krisen der Geschichte bewahrtem Bundesvolk. Mehr dazu in Kap. XII, 1 - 2.
Bubers Leben zeigt: Diesen Weg zu gehen ist möglich, allen Rückschlägen und Katastrophen zum Trotz. Und Abgründe der europäischen Geschichte hat er genug erlebt. 1878 in Wien geboren, ist er 36 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg ausbricht. 55, als Hitler in Deutschland an die Macht kommt. 60, als der mörderische Rassismus der deutschen Nazis ihn in die Emigration nach Palästina zwingt. 61, als der Zweite Weltkrieg Europa in den Abgrund stürzt. 70, als er nach dem Grauen der Schoah die Gründung des Staates Israel erlebt, um den aber von Anfang an ein Krieg mit den arabischen Nachbarn tobt. Wenig hat er nicht erlebt, was Menschen Menschen und Völker Völkern antun können. „Monströse Unmenschlichkeit“ darunter, wie er in seiner Frankfurter Friedenspreisrede 1953 seinem deutschen Publikum acht Jahre nach Ende der Schoah in Erinnerung ruft, tief davon beunruhigt, dass „die Rüstung zur Endschlacht des homo humanus gegen den homo contrahumanus in der Tiefe angehoben“ habe (MBW 6, 95 u. 96). Und dennoch ... „Bubers dialogisches Leben und Denken“ aber, so der um das interreligiöse Gespräch in Deutschland verdiente evangelische Theologe MARTIN STÖHR, „wurde nicht als Einladung und ausgestreckte Hand angenommen. Mit einem Gesicht, das von den jüdischen Nachbarn abgewandt war, lebte die übergroße Mehrheit des deutschen Volkes und der deutschen Kirchen vor 1933. Es war eine ‚Vergegnung’. Sie wurde nach 1933 zur tödlichen Gefahr für das jüdische Volk. Nach 1945 gibt es bescheidene Anfänge einer Neubegegnung.“ (in: A. KOSCHEL - A. MEHLHORN, Hrsg., Vergegenwärtigung, 2006, 133. Ebenso M. STÖHR, Wege und Weggefährten, 2015)
|
|
Überblickt man Bubers ganze Geschichte, erlebt man einen Mann, der sich entschieden abzugrenzen versteht von christlichen Bekenntnissen und deutsch-christlichen Zumutungen. Karl-Josef Kuschel stellt den Kämpfer Buber vor, der für eine eigenständige jüdische Identität streitet und gerade dadurch für Christen ein bleibend interessanter, aber auch unbequemer Gesprächspartner ist.
Karl-Josef Kuschel ist 1948 in Oberhausen/Rheinland geboren, emeritierter Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, lehrte Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs, lebt in Tübingen. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für ökumenische Forschung und im Kuratorium der Stiftung Weltethos.
(3) Sich an 50 Jahre nach seinem Tod an Martin Buber erinnern, heißt drittens sich eines Mannes erinnern, dessen Denken und Glauben eine Herausforderung für das geschichtlich gewachsene Christentum ebenso ist wie für das geschichtlich gewachsene Judentum. Durch sein ungemein vielschichtiges Werk und das Charisma seiner Person hat Buber eine geistige Unabhängigkeit erlangt, die ihn nach allen Seiten unbequem sein liess, im Politischen wie im Religiösen. Gerade auch im Staat Israel, wohin er 1938 übergesiedelt war, als der braune Terror in Deutschland auch nach seinem Leben und dem seiner Famlie zu greifen droht. Doch nach der Staatsgründung warnt Buber mehr denn je davor, dass der Zionismus, für deren geistige Erneuerung er sich früher und intensiver als andere engagiert hatte, in einen politischen Nationalismus abgleiten könnte. Unter „Israel“ verstand er eben mehr als die Gründung eines Staates. „Israel“ als Bundesvolk Gottes ist ihm eine theozentrische Größe mit einem göttlichen Auftrag, den es irdisch - geschichtlich umzusetzen gilt. Als Bundesvolk Gottes ist „Israel“ einzigartig in der Religionsgeschichte der Menschheit, daran hielt Buber zeit seines Lebens fest. Aber zugleich auch daran: „Es geht nicht um das Volk als Selbstzweck, sondern um das Volk als Anbeginn des Reiches“ (JuJ, 232), des Königtums Gottes auf Erden! Das ist „Israels“ Anspruch und Auftrag, für den sich Buber über Jahrzehnte auch politisch im Geist des „religiösen Sozialismus“ einsetzen wird. Der politische Buber ist vom theozentrischen und dialogischen nicht zu trennen: „Es gilt, eine Menschengemeinschaft aufzubauen“, schreibt er 1930, „die sich in der ganzen Breite und Fülle des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Lebens als Gemeinschaft bewährt, die nicht jenseits der natürlichen und sozialen Bindungen, sondern in ihnen die Unmittelbarkeit von Ich und Du verwirklicht. Die Agrargesetzgebung, die im Mittelpunkt der Tora steht, zielt auf einen periodischen Ausgleich der Besitzunterschiede ab, der verhüten soll, dass die Gemeinschaftlichkeit von den immer wieder aufkommenden Differenzen überwuchert werde.“ (JuJ, 232)
Deshalb schliesst Bubers Vorstellung von einer Renaissance des Judentums von innen eine Verständigung und Zusammenarbeit mit den arabischen Nachbarn im Lande Palästina ein und zwar unter dem prophetischen Leitwort „Gerechtigkeit“ (Jes 1, 27). Seit 1921 hatte Buber vor Zionisten unermüdlch dafür geworben, „mit dem arabischen Volk in einem Verhältnis der Eintracht und der gegenseitigen Achtung zu leben und im Bunde mit ihm die gemeinsame Wohnstätte zu einem blühenden Gemeinwesen zu machen“ (Ein Land und zwei Völker, 1993, 93). Damit ist er für die politisch Verantwortlichen auf beiden Seiten unbequem, für Israelis wie Palästinenser. Sie ignorieren seine Ratschläge bezüglich der Schaffung eines binationalen Gemeinschaftsstaates, indem sie ihn als Idealisten und Utopisten abtun (Einzelheiten neuerdings bei: S. WOLF, 2011, 25 - 51) „Gewissen Israels“ nannte ihn nicht zufällig bei seinem Begräbnis 1965 HUGO BERGMANN, ein aus Prag stammender enger Weggefährte Bubers, Professor der Philosophie an der Hebräischen Universität und einer ihrer ersten Rektoren.
Aber auch die Orthodoxie steht Buber ablehnend gegenüber. Nicht von ungefähr. Denn sein Judentum hatte Buber von Anfang an in Kritik am „Rabbinismus“, wie er das nennen konnte, und damit an einer in seinen Augen vergesetzlichten Religionspraxis profiliert. Er ist kein Rabbiner, hatte nie einer werden wollen. Schon einer Synagoge als institutionalisierter Form von „Religion“ steht er skeptisch gegenüber. Zu Gotttesdiensten betritt er keine von ihnen. Wenn er Gebetsräume aufsucht, dann „manchmal“, „unerkannt“ zu Jerusalem „kleine chassidische Betstuben“, so ein Zeitzeuge Bubers, der Publizist und Religionswissenschaftler SCHALOM BEN - CHORIN (1913 - 1999), Betstuben, „in welchen ihn noch etwas von der Atmosphäre jener Jugendjahre umwehte, die er in Galizien bei seinem Großvater auf dem Land verbracht hatte.“ (Zwiesprache mit Martin Buber, 1966, 74) Sich selbst konnte er gelegentlich einen „Erzjuden“ nennen (so in der Friedenspreis - Rede 1953) aber auch einen „keineswegs gläubigen Juden im repräsentativen Sinn“ (MBW 9, 195). Zwar will er keinen prinzipiellen „Anomismus“ vertreten, eine Haltung also, die „Gesetze“ in der Religion verwirft, „aber eben auch keinen „Nomismus“, der Gesetze in der Religion für wesentlich hält. Die „Lehre“ des Judentums“? Sie ist das eine und diese Lehre ist „eine sinaitische, sie ist eine Moseslehre“, schreibt Buber. Aber das andere ist die „Seele“ des Judentums. Und die ist „vorsinaitisch“: „es ist die Seele, die an den Sinai herantritt und da empfängt, sie ist älter als Mose, sie ist urväterhaft, eine Abrahamseele, besser noch: eine Jakobsseele“ (MBW 9, 128).
Diese zwei „Seelen“ fühlte er in seiner Brust: die Seele Abrahams, des Aufbrechenden, des Wanderers vor Gott und die Seele Jakobs, des Gottesstreiters, des Gottgeschlagenen. In beiden Fällen geht es um Menschsein in unmittelbarer Beziehung zu Gott ohne alle vermittelnden Personen oder Faktoren. Es geht die bleibende Ich - Du - Beziehung auch im Verhältnis zu Gott. Und kassischer Ort der lebendigen Zwiesprache Gott - Mensch, Mensch - Gott ist für Buber nicht der rabbinische Diskurs im Talmud, sind vielmehr die Texte der jüdische Bibel in der Polyphonie ihrer Stimmen. Will sagen: Dem Studium der Halacha setzt Buber demonstrativ die Verdeutschung der gesamten Bibel entgegen, aber auch große biblische Studien wie „Das Königtum Gottes“ (1932), „Der Glaube der Propheten“ (1940) oder „Moses“ (1945), von kleineren Arbeiten zu den „Zehn Geboten“ (1929), zu „Abraham der Seher“ (1939), oder zur „Ewählung Israels“ (1938) nicht zu reden.
(4) Sich an Martin Buber erinnern, heisst viertens, eines Menschen gedenken, der in kein Schema passen will, für kein Lager zu vereinnahmen ist. Er ist ein Unangepasster, wie er sich selber nennen kann. Das ist der tiefere, der, wenn man so will, der spirituelle Grund für seine innere Unabhängigkeit, die ihn zu einer solitären Gestalt in der Welt der Religionen des 20. Jahrhunderts hat werden lassen. Diese ihm zugewachsene Stellung hat ihm in der Welt des Judentums massive Kritik eingetragen, auch von persönlichen Freunden. Seine „Ich - Du“ - Lehre sei zwar „ein unveräußerliches Gut“, meinte etwa der Pädagoge ERNST SIMON (1899 - 1988), einer seiner engsten Weggefährten, aber Buber habe die „Ich - Wir“ Beziehung der Juden vernachlässigt, die sich in der Synagoge begegnen (zit. nach K. YARON, M.B, 2002, 173). Andere urteilen wesentlich härter. Einen „religiösen Anarchisten“ nennt ihn sein schärfster wissenschaftlicher Kritiker, der Kabbala - Spezialist GERSHOM SCHOLEM (1897 - 1982), als er Bubers „Deutung des Chassidismus“ einer scharfen Kritik unterzog (in: Judaica, 1963, 197). Sein schärfster „halachischer“ Kritker, JESHAJAHU LEIBOWITZ (1903 - 1994), etikettiert ihn als „jüdischen Theologen für Nicht - Juden“, was verächtlich gemeint ist. Bubers „Ansichten“, meint er süffisant, stünden „in keinem Bezug zu dem historischen Judentum - das ein Judentum der Tora und der Mitzwot“ sei, ein Judentum also, das ein Leben nach der Tora und ihren Geboten verlangt. Deshalb sei „Bubers Lehre keine jüdische Theologie“ (Gespräche über Gott und die Welt, 1990, 55f.)
Aber wer Buber wirklich verstehen will, muss dieses sein ganz persönliches Profil zu verstehen suchen, die Einzigartigkeit und Eigenwilligkeit seines Denkens und Glaubens, seinen dialogischen Stil bei Begegnungen und Gesprächen, die er mit einem wunderbaren alten deutschen Wort „Zwiesprache“ nennen kann. (Zum Selbstverständnis Bubers: CH. SCHÜTZ, Verborgenheit, 1975, 11 - 64). Deshalb mühen wir uns um Annäherung an ihn, nicht obwohl, sondern weil er das alles nicht ist: keine genormte Figur, wie man sie so häufig in der Welt der Religionen antrifft, abgeschliffen bis zur Unkenntlichkeit, glattpoliert bis zur Ungriffigkeit, korrekt bis zur Profillosigkeit. Buber aber ist kein Anpasster, keiner, der zu Lagern gehörte, keiner, den man nach Schemata sortieren könnte. Sein Deutsch gibt die beste Antwort auf die Frage, wer er war, die Sprache, die Buber für seine Bibelübertragungen fand und erfand. Sie spiegelt ihn als Person: in seinem eigenwilligen, ja beispiellosen Versuch, das in Vergessenheit geratene Hebräische Original über das Deutsche noch hörbar zu machen. Deshalb holt er Versunkenes, Verschollenes aus den Tiefen der deutschen Sprachgeschichte an die Oberfläche, nimmt schöpferisch neue Wortbildungen vor, zwingt durch ungewohnte Wortstellungen und Satzbildungen zur Verlangsamung des Lesens und damit zum Nach - Denken und und Laut - Sprechen des Textes. Ein Buber - Deutsch hat er kreiert, das sich dem gefälligen Konsum verweigert, der glatten Lippe, dem zugreifenden „Schon-Verstanden.“ Dabei verstand er es wie kaum ein Anderer, die Andersheit des biblischen Gegenübers so aufzuschließen, dass dessen Fremdheit nicht abstoßend, sondern anziehend gewirkt hat.
Mit ALBRECHT GOES (1908 - 2000), evangelischer Pfarrer und Schriftsteller, Vordenker einer anderen christlichen Israel -Theologie nach der Schoah und Laudator Bubers bei dessen Entgegennahme des Friedenspreises 1953, halte ich fest: „Buber musste zeit seines Lebens und ausdrücklich dann im Alter für die Ideologen aller Schattierungen eine ständige Anfechtung sein: den Orthodoxen war er nicht fromm genug, den Nationalisten zu araberfreundlich; für die jungen Fortschrittsgläubigen war er ein abendländisches Museum, und für einen Teil der philosophischen Köpfe, der psychologischen, psychoanalytischen Theoretiker und Praktiker galt er als ein Relikt aus biblischer Tradition, ehrwürdig und vergangen.“ (H. ZWANGER, ALBRECHT GOES, 2008, 113) Aber all diese Klischees? Sie prallen an der Unverwechselbarkeit von Weg, Werk und Wirkung dieses Mannes ab, der wie nur wenige Denker des 20. Jahrhunderts Wirkungen in den verschiedensten Disziplinen zu erzielen vermochte: nicht nur in der Welt von Sprach- und Bibel- und Religionswissenschaft oder der Philosophie, sondern auch in der Welt der Pädagogik, der Erwachsenenbildung, der Psychologie und Psychotherapie sowie der Politischen Theorie und Sozialphilosophie. Die neue, große Martin - Buber- Werkausgabe ist nicht zufällig auf 21 Bände ausgelegt. Interdisziplinäre Grenzüberschreitungen? Buber hat davon nicht geredet, er hat sie gelebt. Wer sich somit die Mühe macht, in die Themen, Strukturen und Verzweigungen dieses komplexen Werkes hineinzugehen, wird reich beschenkt. Billiger ist Buber nicht „zu haben“.
(5) Sich an Martin Buber erinnern, heisst fünftens, eines homo religiosus gedenken, der aus der Freiheit einer ganz persönlichen Gottesbeziehungen heraus gelebt und gedacht hat, nicht „freischwebend“ in subjektiver Beliebigkeit selbstverständlich, sondern als Antwort auf das „ewige Du“ Gottes und damit in Zwiesprache mit diesem Du, wie es ihm vor allem aus den Überlieferungen der Jüdischen Bibel entgegenkam. Denn hier, in dieser Schrift, meinte Buber die ingeniöse Synthese aus Humanismus und Religiosität gefunden zu haben, verschmolzen zu dem, was er einen „biblischen“ oder „hebräischen Humanismus“ genannt hat (JuJ, 717-729; W II, 1087-1092). Authentisch Menschsein aus jüdischen Quellen: das ist sein Programm. Nicht weniger an Humanität leben als alle Humanisten, aber tiefer begründet in der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Gemeint ist also weder ein neuzeitlicher Humanismus ohne Gott noch ein Gottesglaube auf Kosten des Humanum. Weder ein Plädoyer für eine Autonomie, die auf eine Selbstbindung an Gott verzichten zu können meint, noch eine Theonomie, die den Menschen fremdbestimmt. Gemeint ist - mit einem ungemein kühnen Wort Bubers: „Verwirklichung Gottes durch den Menschen“ (W I, 384). Sieht Buber den Menschen doch „als das Wesen, durch dessen Dasein das in seiner Wahrheit ruhende Absolute den Charakter der Wirklichkeit gewinnen kann.“ (W I, 384) So geht ein beinahe tollkühnes Vertrauen vom Gottes - und Menschenbild diese Mannes aus, nicht blauäugig - abgehoben, sondern tief erfahrungsgesättigt. Bei aller Wahrung der Freiheit Gottes, eine Selbstverpflichtung auf aktive Verwirklichung Gottes durch den Menschen bis in der Raum von Politik und Gesellschaft hinein.
(6) An Martin Buber erinnern, heisst sechstens sich an einen der schärfsten Kritiker der real existierenden Religionen erinnern, einen Kritiker notabene um der Unverfügbarkeit des lebendigen Gottes willen. Seinen „Standort“? Den sah Buber eher auf einem „schmalen Grad“ als auf der „breiten Hochebene eines Systems“, von dem aus man „sichere Aussagen über das Absolute“ machen könnte. Eher „auf einem engen Felskamm zwischen den Abgründen“, „wo es keinerlei Sicherheit eines aussagbaren Wissens gibt“, nur „die Gewissheit der Begegnung mit dem verhüllt Bleibenden.“ (W I, 383f.) Nichts fürchtet er mehr, als dass die je neue lebendige Begegnung eines Menschen mit Gott in der Unmittelbarkeit der Ich - Du - Beziehung ersetzt werden könnte durch eine Verdinglichung Gottes, eine Verfügbarmachung, das Herabsinken in das, was er die „Eswelt“ nennt. Für ihn kann das „ewige Du“, Gott, niemals in die Es - Welt zurückfallen, mag auch die menschliche Rede von Gott hinter die gewünschte Unmittelbarkeit zurückfallen. Hier, in der Wahrung dieser Unmittelbarkeit jedes Menschen vor Gott, liegt der tiefste Grund verborgen, warum Buber auch die Tora nicht als vermittelnde Größe zwischen Gott und Mensch akzeptieren kann, warum er als glaubender Mensch einer „Abrahamseele“ und einer „Jakobsseele“ den Vorrang gibt.
Deshalb konnte Buber seinen Kritikern, die ihm die Verwendung allzu paradoxer Ausdrücke geworfen hatten, antworten: „Gott wird durch jedes Wort eingeschränkt, das ihn nicht zum Empfänger, sondern zum Gegenstand hat; nicht von Gott, sondern von der Begegnung reden wir. Der Begegnung gegenüber aber verhält es sich so, dass die ‚paradoxalen Ausdrücke’ ihre unvergleichliche, unsubsumierbare Einmaligkeit respektieren, die durchlogisierten nicht.“ (Antwort, in: M.B., hrsg.v. P.A. SCHILPP - M. FRIEDMAN, 1963, 600). Somit ist Bubers ganzes Denken und Schreiben eine einzige Warnung vor der Verdinglichung Gottes (durch Lehrsätze beispielsweise), vor der Verzweckung Gottes (durch religiösen Betrieb in vielen Formen), vor Gebrauch und Verbrauch Gottes (durch fromme Bedürfnisse aller Art). Ein solcher Gottesverbrauch hatte zu der „Gottesfinsternis“ geführt, die Buber nach 1945 als „Charakter der Weltstunde“ diagnostizieren sollte. Kein Zufall somit, dass einer unter den großen christlichen Theologen des 20. Jahrhunderts, PAUL TILLICH (1886 - 1965), nach vielen persönlichen Begegnungen mit Buber in seinem Nachruf 1965 das Erlebnis einer Person gerühmt hat, deren ganzes Sein von der Erfahrung der göttlichen Gegenwart durchdrungen gewesen sei. Gleichsam gott - besessen sei dieser Mann gewesen. In seiner Gegenwart habe „Gott“ nie zu einem Objekt werden können. In der Tat: Die Mitte seines Denkens ist der Gott, der einst von sich sagte: „Ich werde dasein als der ich dasein werde.“ (Ex 3, 14) Eine göttliche Wirklichkeit, präsent, aber entzogen, wirklich, aber nicht fassbar, anredend, aber nicht greifbar, fordernd, aber nicht verfügbar. Wenn, dann geht es um Begegnung mit dem verhüllt Bleibenden.
„Rückendeckung“ für diese Art der Religionskritik aus dem Geist einer konsequenten Theozentrik hatte Buber sich schon früh bei derjenigen jüdischen Traditionn geholt, die er am meisten liebte: bei den „Erzählungen der Chassidim“ (s. Kap. III). Und eine der vielen pointierten Geschichten, der Gründerfigur des Chassidismus, dem BAAL-SCHEM -TOW, in den Mund gelegt, lautet: „Der BAALSCHEM blieb einst an der Schwelle eines Bethauses stehen und weigerte sich, es zu betreten. ‚Ich kann nicht hinein’, sagte er, ‚es ist ja von Wand zu Wand und vom Boden zur Decke übervoll der Lehre und des Gebetes, wo wäre da noch Raum für mich?’ Und als er merkte, dass die Umstehenden ihn anstarrten, ohne ihn zu verstehen, fügte er hinzu: ‚Die Worte, die über die Lippen der Lehrer und Beter gehen und kamen nicht aus einem auf den Himmel ausgerichteten Herzen, steigen nicht zur Höhe auf, sondern füllen das Haus von Wand zu Wand und vom Boden zur Decke.“ (W III, 189)
Noch kurz vor seinem Tod hat Buber uns einen Text hinterlassen, der die Pointe zu dieser Geschichte liefert. Angesichts einer monströsen Missbrauchsgeschichte der Religionen, die auch 50 Jahre nach seinem Tod nicht kleiner geworden ist, lohnt sich gerade auch das in Erinnerung zu rufen. Die geschichtlichen Religionen? Sie haben, so Buber, „die Tendenz, Selbstzweck zu werden und sich gleichsam an Gottes Stelle zu setzen“. Nichts sei so geeignet, „dem Menschen das Angesicht Gottes zu verdecken, wie eine Religion.“ Konsequenz? „Die Religionen müssen zu Gott und zu seinem Willen demütig werden; jede muss erkennen, dass sie nur eine der Gestalten ist, in denen sich die menschliche Verarbeitung der göttlichen Botschaft darstellt, – dass sie kein Monopol auf Gott hat; jede muss darauf verzichten, das Haus Gottes auf Erden zu sein, und sich damit begnügen, ein Haus der Menschen zu sein, die in der gleichen Absicht Gott zugewandt sind, ein Haus mit Fenstern; jede muss ihre falsche exklusive Haltung aufgeben und die rechte annehmen.“ (Nachlese, 1966, 111). Bubers Herausforderung gerade auch als theozentrischer Denker in der Welt der real existierenden Religionen ist bleibend lebendig. Wir werden mehr davon hören (Kap. XII).
Probe-Abonnement
![]()
Infodienst
! 5 Augaben kostenfrei und unverbindlich !
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo:
(7) Sich an Martin Buber erinnern, heisst siebtens, sich an einen Mann erinnern, der früher als andere die Doppelgesichtigkeit der religiösen Situation der Zeit erkannt hat. Sie ist auf der einen Seite gekennzeichnet durch eine lähmende „Gottesfinsternis“ und damit durch den Bedeutungsschwund der Religionen weltweit unter den Bedingungen von Aufklärung und Säkularismus, andererseits durch einen Bedeutungszuwachs im Blick auf die Nowendigkeit der Zusammenarbeit bei Menschheitsaufgaben: „Jede Religion ist ein Exil, in das der Mensch vertrieben ist“, kann Buber schreiben. Eine auf den ersten Blick sonderbare Wortwahl: Jede „Religion“ - ein „Exil“. Mit diesem Bild aber macht Buber ernst mit der Tatsache, dass Religionen im Gegenüber zu Gott Menschenwerk sind, keine absoluten Größen und unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden Selbstdurchsetzung Gottes stehen. In diesem Sinne sind Religionen Orte des Exils und keine Heimat, in der man angekommen wäre, Provisorien, die ihrer Vollendung harren. „Aber die Religionen, die das wissen“, kann Buber fortfahren, „sind in der gemeinsamen Erwartung verbunden; sie können einander Grüße von Exil zu Exil, von Haus zu Haus durch die offenen Fenster zurufen. Doch nicht das allein: sie können miteinander in Verbindung treten und miteinander zu klären versuchen, was von der Menschheit aus getan werden kann, um der Erlösung näher zu kommen; es ist ein gemeinsames Handeln der Religionen denkbar, wenn auch jede von Ihnen nicht anders handeln kann als im eigenen Haus.“ (Nachlese, 1966, 110f.)
Und dieses gemeinsame Handeln ist umso dringlicher als die Menschheit sich auch dem dem 2. Weltkrieg neuen epochalen Bedrohungen ausgesetzt sieht. Der Abwurf von Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagsaki hatte zwar den 2. Welkrieg beendet, aber die Sorge um die Zukunft der Menschheit zu einer „unheimlichen Beängstigung“ werden lassen, wie Buber in einer Stellungnahme 1959 erklärt (MBW 9, 328). Supermächte stehen sich gegenüber, die sich mit atomarer Vernichtungsdrohung wechselseitig in Schach halten. Hier sieht Buber die Religionsgemeinschaften weltweit gefordert. Es müsse erstens „eine gründliche Wandlung des Toleranzbegriffs“ geben; es könne nicht länger um blosse „Duldung“ gehen, vielmehr um einen „gemeinsamen Dienst am Menschen“. Und zweitens sei eine „planetarische Zusammenarbeit“ der Religionen vonnöten, und derjenigen zwischen Christentum und Judentum komme „eine besondere Bedeutung“ zu. „Planetarische Zusammenarbeit“ der Religionen! Es würde sich lohnen, diesem Motiv im Buberschen Werk noch weiter nachzugehen und es mit heutigen Diskursen um religionsübergreifende ökumenische Zusammenarbeit und ein gemeinsames Menschheitsethos zu verknüpfen.
Fingerzeige hat Buber selber gegeben sowohl in seiner Friedenspreisrede 1953 (MBW 6, 95 - 101) als auch in seinen Würdigungen von Figuren auf der Ebene von Weltpolitik und Weltliteratur. Ich denke an den damaligen UNO-Generalsekretär DAG HAMMARSKJÖLD (1905 - 1961; im Amt 1953 - 1961) und den Schriftsteller HERMANN HESSE. Mit HAMMARSKJÖLD, der vor seinem tragischen Flugzeugabsturz 1961 während einer Friedensmission im Kongo eine Übersetzung von Bubers „Ich und Du“ ins Schwedische begonnen und in zwei Treffen 1958/59 in New York und Jerusalem den Austausch mit Buber gesucht hatte, ist er sich einig, dass es angesichts des Kalten Kriegs und einer ideologischen Spaltung der Menschheit ein „echtes Gespräch“, eine „echte Verhandlung“ zwischen den Völkern geben müsse, „gemeisame Realisierung der großen gemeinsamen Interessen oder das Ende all dessen, was man auf der einen oder der anderen Seite die menschliche Zivilisation zu nennen pflegt“ (Nachlese, 1965, 34). So Buber in einem Nachruf auf HAMMARSKJÖLD. HERMANN HESSEs Werk würdigt er 1957 anlässlich des 80. Geburtstag des Dichters als „Dienst am Geist“, was insbesondere für dessen universalistisch ausgerichtetes Spätwerk „Die Morgenlandfahrt“ (1932) und „Das Glasperlenspiel“ (1943) gilt. Buber kann diese seine Würdigung mit Sätzen abschließen, die einem einzigartigen Liebesbekenntnis zu HESSE gleichkommen: „Nicht die Morgenlandfahrer und die Glasperlenspieler allein grüßen dich heute in aller Welt, Hermann Hesse. Die Diener des Geistes in aller Welt rufen dir mitsammen einen großen Gruß der Liebe zu. Überall, wo man dem Geiste dient, wirst du geliebt.“ (Nachlese, 1995, 63. Einzelheiten zu Buber - HAMMARSKJÖLD bei LOU MARIN, 2011 u. MAURICE FRIEDMAN, M.B., 1999, Kap. 20; zu HESSE: Nachlese, 1965, 51 - 63; B III, bes. 184; 225f.; 443; 450f. u. J. WASSNER, 2015)
(8) Sich an Martin Buber erinnern, heisst achtens, sich an einen kritischen Partner im Gespräch mit Christen erinnern und ihren Glauben an den Juden Jesus von Nazareth als Messias, Gottes Sohn und Erlöser. Hier konnte Buber streiten, manchmal kämpferisch, bisweilen auch polemisch, aber immer an der Sache orientiert. Christen berufen sich nun einmal auf Jesus von Nazaret, der ein Jude des 1. Jahrhunderts war, also hat Buber als religionsgeschichtlich ausgewiesener jüdischer Gelehrter etwas dazu zu sagen. Als solcher bringt er eine andere Sensiblität für Person und Sache Jesu mit als Heidenchristen aller Couleur. Buber ist 32 Jahre alt, als er 1910 in Prag im Rahmen seiner programmatischen „Reden über das Judentum“ erstmals öffentlich zu Jesus, dem Urchristentum und „dem Christentum“ Stellung bezieht. 72, als er 40 Jahre später 1950 seine wichtigste und umfassendste Schrift zum „Christentum“ vorlegt: „Zwei Glaubensweisen“. Über Jahrzehnte hat Buber Christen den Spiegel vorgehalten, und wir heute, mehr denn je interessiert am Authentischen der Ursprünge Jesu, haben dafür eine größere Sensibilität als Generationen vor uns. Wir haben Tradtionsabbrüche erlebt, die neu und radialer denn je fragen lassen, was denn das ursprünglich und spezifisch Christliche noch ausmacht, wenn nicht die Figur Jesu selber, der mit seiner Botschaft vom „Reich Gottes“ in seine Nachfolge ruft. Wer auf Jesus trifft, trifft nun einmal auf das Judentum. Wie oft ist das vergessen worden. Schon GOTTHOLD EPHRAIM LESSING (1729 - 1781) hatte nicht zufällig in seinem Stück „Nathan der Weise“ 1779 einen Christen selbstkritisch daran erinnern lassen: „Und ist denn nicht das ganze Christentum / aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft / Geärgert, hat mir Tränen gnug gekostet / Wenn Christen gar so gern vergessen konnten / Dass unser Herr ja selbst ein Jude war.“
Bubers Fragen sind schonungslos. Der christliche Erlöser Glaube „an“ Christus? Hat er sich nicht schon früh, bei PAULUS und Johannes angefangen, von der „Reich - Gottes“ - Botschaft Jesu mehr und mehr entfernt? Wurde der Mann aus Nazareth nicht im Laufe der Jahrunderte unter dem Einfluss einer nichtjüdischen Kultur von seinem jüdischen Mutterbode getrennt? Und was war der Preis, den „das Christentum“ dafür zahlte? Hat nicht ein Prozess der „Vergottung“ Jesus stattgefunden, der von Jesus selber weder gewollt noch verstanden worden wäre? Und wurde damit nicht der Zugang der Menschen zu Gott vom wahren Glauben an Christus abhängig gemacht? Allein durch Christus ist Seelenheil verbürgt, dann allein durch die Kirche? Trat nicht eine Spaltung ein in Gläubige und Ungläubige, Erlöste und Verdammte, Gerettete und Verlorene? Mit fatalen Folgen für Menschen anderen Glaubens? Bubers kritische Distanz, sein Blick von außen, tut Christen gut, die noch wach sind für die Frage nach dem ursprünglich Jesuanischen, noch sensiblisierbar für eine dunkle Seite am „Christentum“: die Israelverachtung und Israelvergessenheit. Selbstkritisch nach dem Grauen der Schoah sagen auch viele Christen heute: Die dunkle Seite des Christusglaubens war Jahrhunderte lang der rücksichtslose Antijudaismus in Theologie, Verkündigung und Katechese der Kirche: eine fatale Theologie der Enterbung und Ersetzung. Wie selbstverständlich hatte man Israel als „Volk Gottes“ für „enterbt“ erklärt; es hatte ja auch den Messias aus Nazareth getötet, war nach der Zerstörung des Tempels zu Jerusalem 70 n.Chr. angeblich von Gott mit „Zerstreuung“ unter die Weltvölker „bestraft“ und deshalb zu einer unruhig über die Erde wandernden Schattenexistenz „verdammt“ worden. Wie selbstverständlich ging man als Kirche davon aus, man habe Israel als das neue Volk Gottes ersetzt. Entsprechend erwartete man Bekehrung und Taufe von Juden, praktizierte offensive Juden - Mission.
Davon vor allem und von Bubers Reaktionen darauf wird auf den folgenden Seiten zu berichten sein. Aber deutlich wird auch: Buber übt nicht nur Kritik, geht nicht nur auf kritische Distanz, sondern entwickelt auch Figur eines echten Gesprächs mit Christen, zeigt Konvergenzen im Glauben und in der Erwartung, aber auch Möglichkeiten der gemeisamen Arbeit zum Wohl der Menschheit. Wir werden auf den folgenden Seiten davon berichten: In einer Zeit, in der von einem „Dialog“ von Christen mit Juden noch keine Rede sein kann, ja das Judentum in Deutschland mehr denn je einer rassistischen Hetz-, Verleumdungs- und Vertreibungskampagne ausgesetzt ist, in einer Zeit, in der Vertreter kirchlicher Theologen immer noch auf eine Bekehrung von Juden warten und offensiv für Mission an Juden werben (KARL LUDWIG SCHMIDT, Kap. X, 1-3), ja in einer Zeit, in der christliche Theologen allen Ernstes für eine Reduktion jüdischen Lebens auf einen geduldeten „Gaststatus“ öffentlich plädieren, für eine erzwungene „Fremdlingschaft unter den Völkern“ als endgültiger „Lösung der Judenfrage“ (GERHARD KITTEL, Kap. IX, 1-5), in einer solchen Zeit wagt Buber, ein „neues zukunftsweisendes Gespächsangebot“ (D. KROCHMALNIK) zu machen: Anerkennung nicht nur der Andersheit des je Andersglaubenden, sondern auch der Verschiedenheit der Gottesgeheimnisse. Der je Andere hat „ein Realverhältnis zur Wahrheit“! Das gilt es anzuerkennen (MBW 9, 137), ohne die Gegensätze inhaltlich zu überspielen oder gar aufzulösen. Verständigung über Glaubensinhalte kann es letztlich nicht geben, wohl aber Verstehen der Andersheit des Anderen. Buber entwirft damit kühn „auf eigene Verantwortung“ das, was wir heute eine Theologie der Alterität nennen, eine Theologie des Anderen. Für Juden ist diese „Realverhältnis zur Wahrheit“ ein für allemal grundgelegt im Bund Gottes mit Abraham und dessen Nachkommen „auf ewig“. Dieser Bund ist von Gott „nicht aufgekündigt“ worden, was immer in der Geschichte geschehen ist. Das ist Bubers unerschütterliche Glaubensüberzeugung. Auch die grauenhaften Ereignisse der Schoah konnten ihn davon nicht abbringen. Mehr dazu in den entsprechenden Kapiteln dieses Buches (X, 8-9 u. XII, 5).
Christen ihrerseits haben die entsetzlichen Ereignisse der Schoah gebraucht, um zu erkennen, dass schon der Judenchrist und Völkerapostel PAULUS auch nach dem Christus - Ereignis an der „Erwählung“ Israels durch Gott festgehalten hat. „Hat Gott sein Volk verstoßen?“, fragt PAULUS zu Beginn des 11. Kapitels im Brief an die Römer, und antwortet: „Keineswegs. Denn auch ich bin Israelit, ein Nachkomme Abrahams, aus dem Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er einst erwählt hat“ (11, 1f.). Und später heisst es in demselben Kapitel: „von ihrer Erwählung her sind sie von Gott geliebt, und das um der Väter willen. Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt.“ (Röm 11, 28f.) Die Gott gewährt! Deshalb macht für Buber der Dialog zwischen Juden und Christen nur Sinn, wenn es nicht um wechselseitige Bekehrung zu dem einen oder anderen „Lager“ geht, sondern ausschließlich um eine Umkehr zu Gott selbst. Der Jude soll nicht Christ und der Christ nicht Jude werden, sondern beide sollen zu Gott umkehren und daraus Konsequenzen für ihr Leben ziehen. Das ist Bubers theozentrische Botschaft im Dialog. „Judentum und Christentum“, schreibt er 1949 dem katholischen Theologen KARL THIEME, „stehen miteinander im Geheimnis unseres Vaters und Richters: so darf der Jude vom Christen und der Christ vom Juden nicht anders als in Furcht und Zittern vor dem Geheimnis Gottes reden. Auf dieser Grundklage allein kann es zwischen Jude und Christ eine Verständigung geben.“ (MBW 9, 192)
(9) Sich an Martin Buber erinnern, heisst neuntens, sich auf einen Mann einlassen, dem es zuzuhören gilt. Ihn wollen wir auf den folgenden Seiten so authentisch wie möglich zu Wort kommen lassen, ihm wollen wir zuhören und seine mit den „alten“ Augen eines Juden gemachten Beobachtungen am Glauben von Christen wahrnehmen, verstehen und bedenken. Das braucht Zeit und Geduld. Der Abstand von vielen Jahrzehnten kann nicht einfach eingeebnet werden. Wir suchen Begegnung mit Bubers Denken, nicht den Konflikt mit ihm, Verstehen, nicht Streit, Zuhören, nicht Apologie. Wir wollen ihn ausreden lassen und ihm nicht gleich ins Wort fallen oder einen Diskussionsbericht darüber liefern, wie von christlicher oder jüdischer Seite reagiert wurde, welche Kritik Buber erfuhr, welche Einsprüche und Gegenrede. Einige wenige Fingerzeige werden unvermeidlich sein, aber dieses Buch ist kein Buber - Forschungsbericht und auch kein Bericht über die Rezeption, die er vor und nach seinem Tod von christlichen Theologen erfahren hat. Vieles davon ist zu finden in dem von mir edierten und kommentierten Band 9 der großen Martin - Buber - Werkausgabe (= MBW), der 2011 erschienen ist. Das Nötige mit zahlreichen Literaturhinweisen ist dort nachzulesen.
(10) Sich auf Martin Buber einlassen, heisst zehntens, ihn aus der Mitte seines Denkens heraus verstehen. Nicht um Einzelfragen geht es, etwa zur Christologie, speziell zur Messianität Jesu oder zur Verbindlichkeit des Religionsgesetzes („Halacha“) für Juden. Deren kritische Evaluation ist Sache einer Spezialforschung, die es zu Buber reichlich gibt. In diesem Buch geht es darum, die Einzelfragen in das Ganze von Bubers Gottes- und Religionsverständnis einzuordnen, sie von der Mitte seines Denkens her zu verstehen. Bubers Kernliegen als glaubender Mensch, theologischer Denker und jüdischer Partner im Dialog soll zu Leuchten kommen. Es läßt besser verstehen, warum er bei aller Anerkennung des Glaubens Anderer Vorbehalte anmeldet, Kritik übt, Protest einlegt und vor allem: Alternativen entwickelt, Gesprächsangebote macht. Das gilt es noch einmal freizulegen und anzuschauen, um es für heute fruchtbar zu machen. Man hat ihn nicht zu Unrecht den „Nestor“ des heutigen jüdisch-christlichen Dialogs genannt. Aber zu fordern ist im Dialog von Juden und Christen heute gewiss nicht einfach ein „Zurück zu Buber“, wohl aber mit Blick nach vorn ein entschiedenes: „Nicht unter Bubers Niveau“.
Der Autor
Homepage: siehe auch:
 Geboren 1948 in Oberhausen/Rhld. Studium der Germanistik und Katholischen Theologie an den Universitäten von Bochum und Tübingen. 1977 Promotion zum Doktor der Theologie in Tübingen mit einer Arbeit zum Thema „Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“, betreut durch Prof. Hans Küng und Prof. Walter Jens.
Geboren 1948 in Oberhausen/Rhld. Studium der Germanistik und Katholischen Theologie an den Universitäten von Bochum und Tübingen. 1977 Promotion zum Doktor der Theologie in Tübingen mit einer Arbeit zum Thema „Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“, betreut durch Prof. Hans Küng und Prof. Walter Jens.
1989 Habilitation für „Ökumenische Theologie“ an der Eberhard Karls Universität Tübingen mit einer Arbeit zum Thema „Geboren vor aller Zeit? Der Streit um Christi Ursprung“. Seit 1995 Professur für „Theologie der Kultur und des interrreligiösen Dialogs“ an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Tübingen und stellvertretender Direktor des Instituts für ökumenische und interreligiöse Forschung. Von 1995 bis 2009 Vizepräsident der Stiftung Weltethos (Tübingen), seither Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Weltethos und seit 2012 im Kuratorium der Stiftung.
http://karl-josef-kuschel.de/
Kontakt zum Autor und/oder COMPASS:
redaktion@compass-infodienst.de
ONLINE-Extra Nr. 195
Karl-Josef Kuschel:
Theodor Heuss. Die Shoah, das Judentum, Israel.